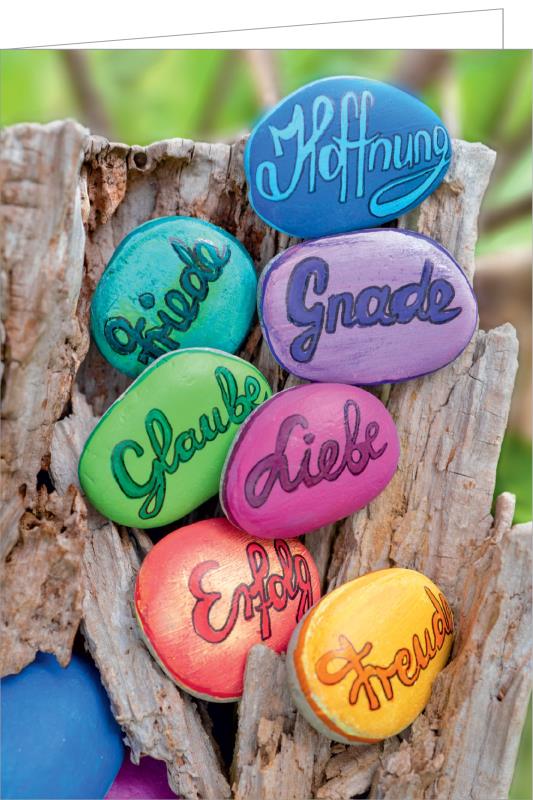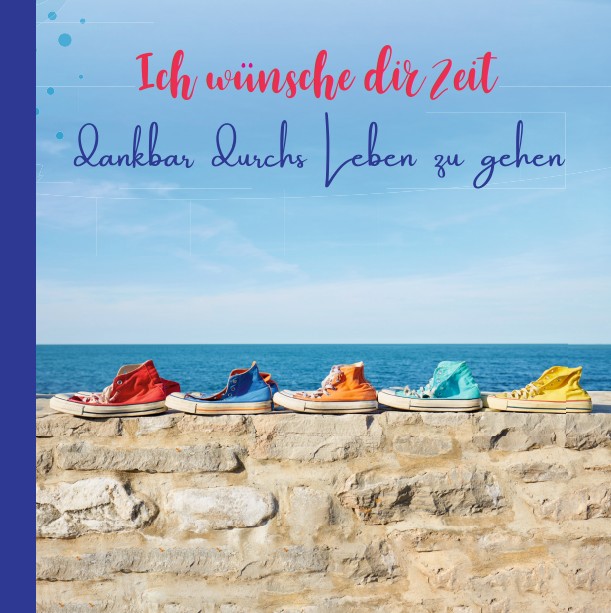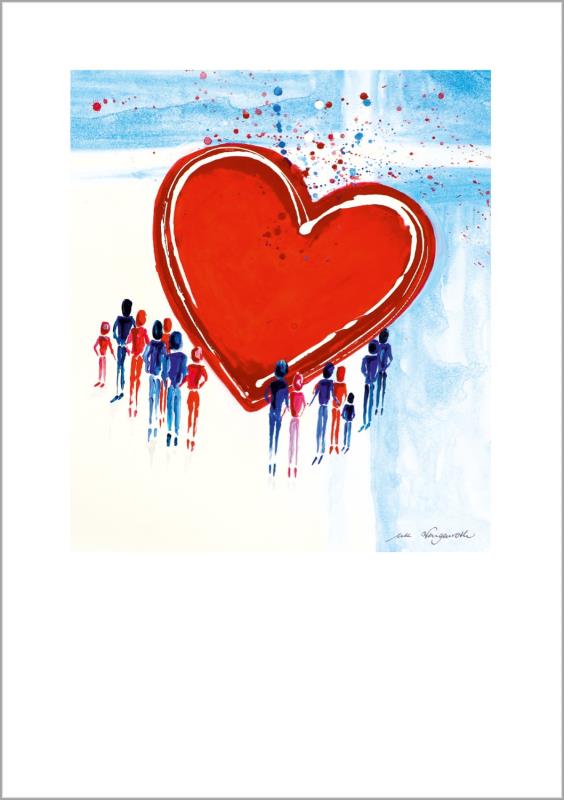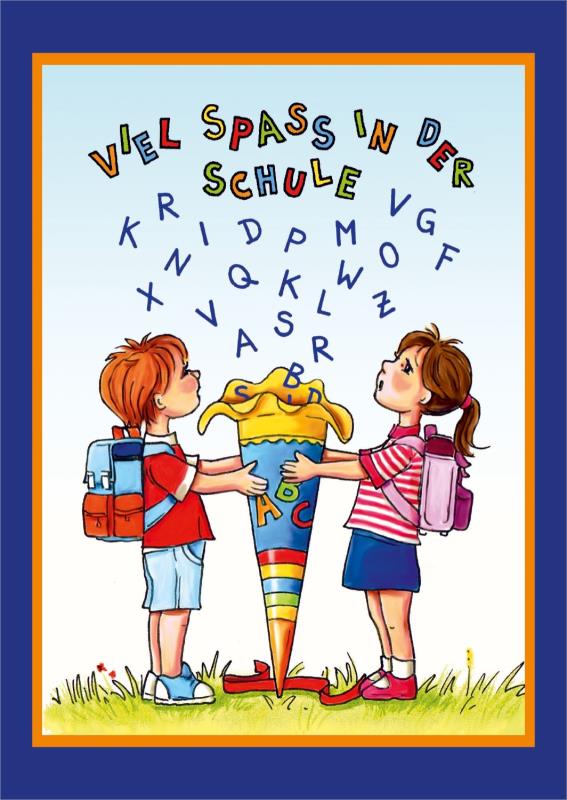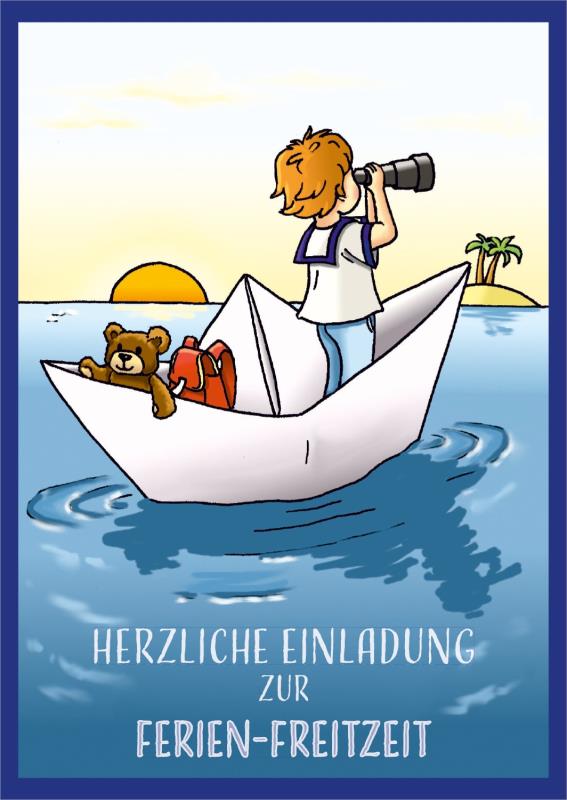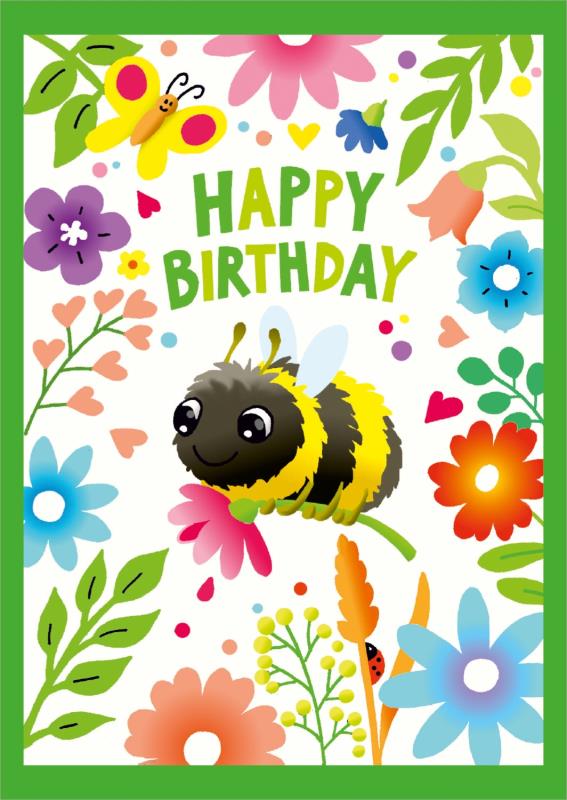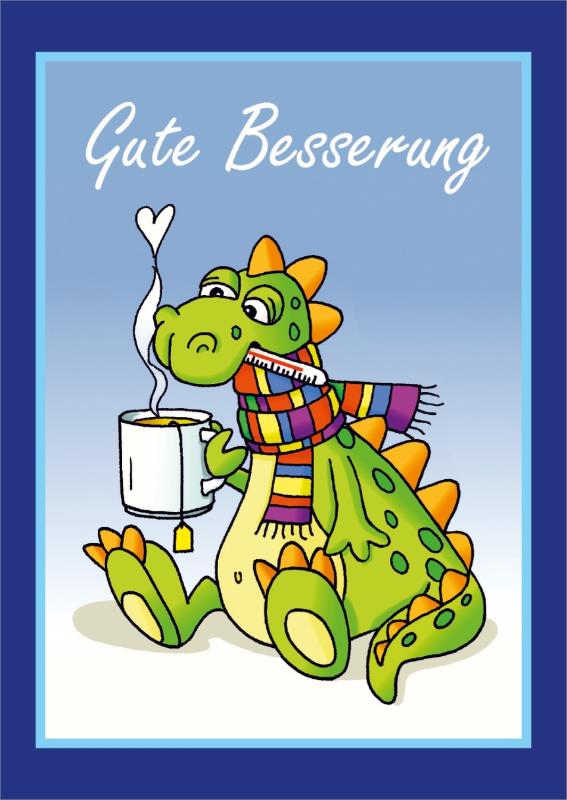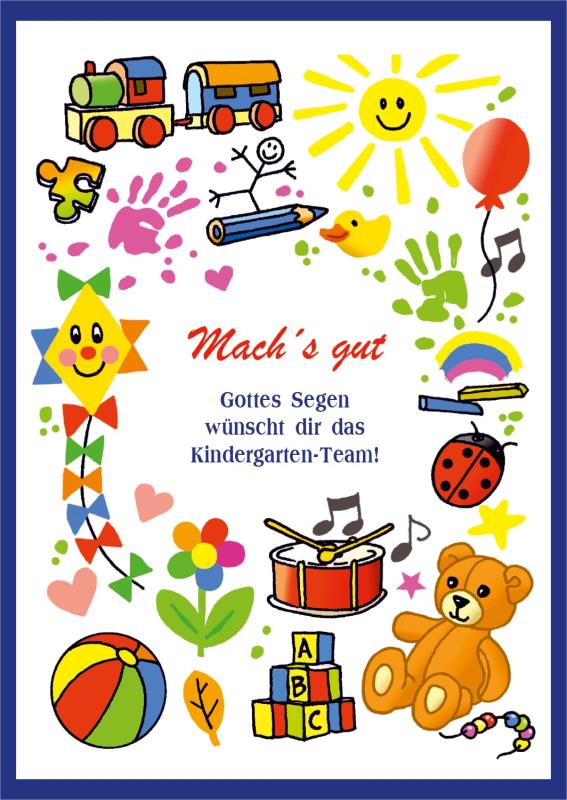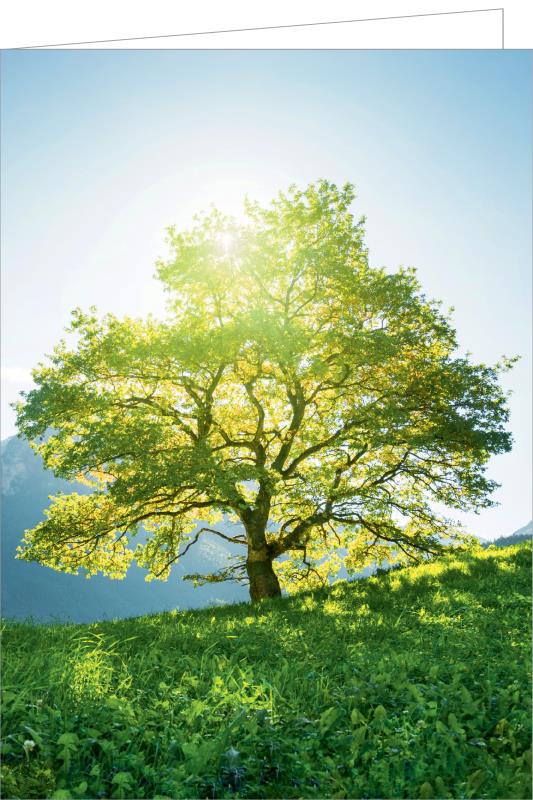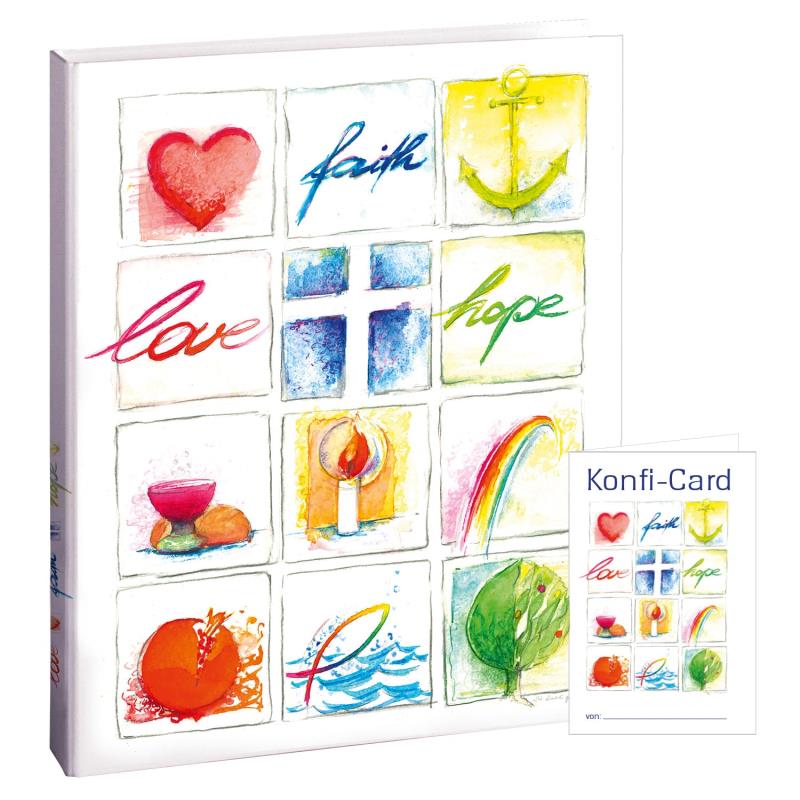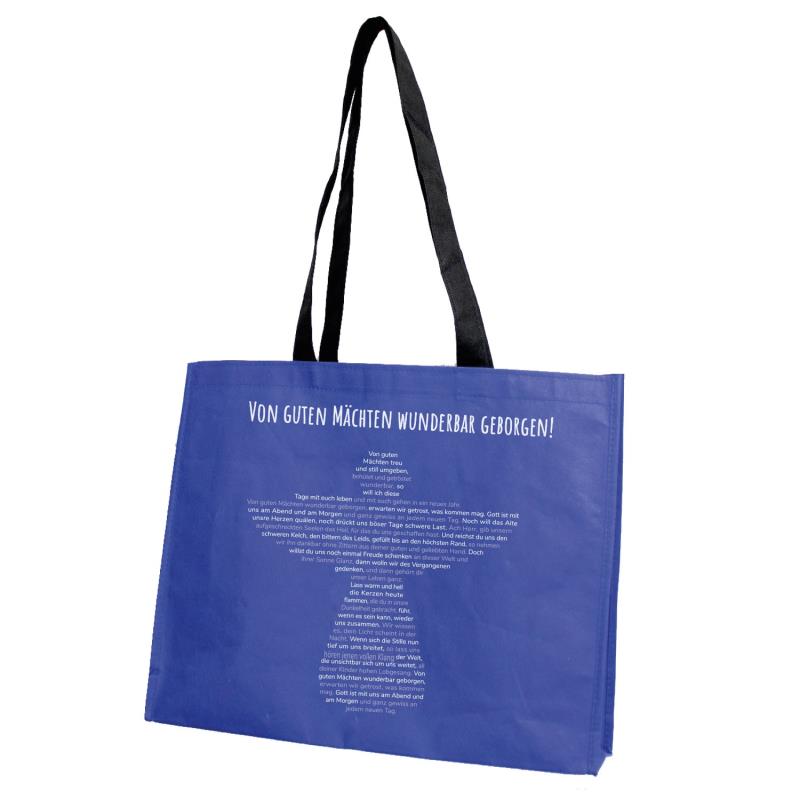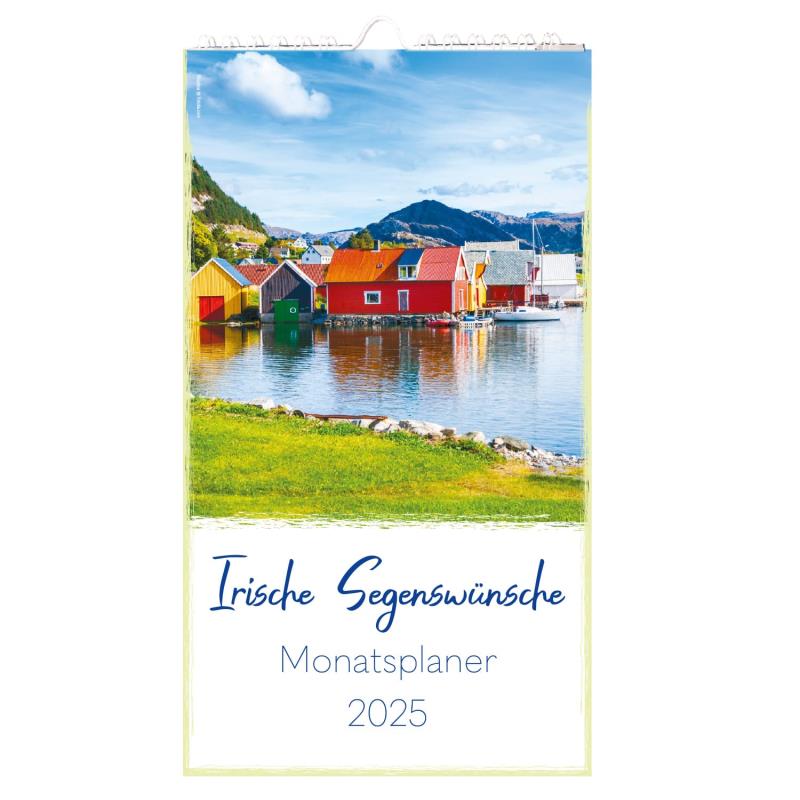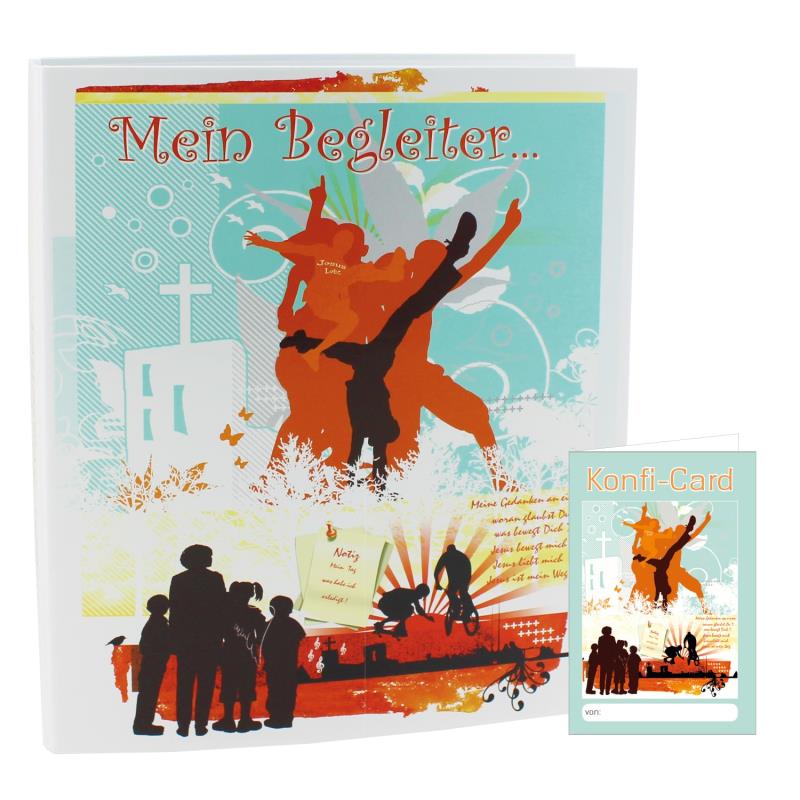-
A
AT – Das 1. Buch Mose (Genesis) AT – Das 1. und 2. Buch Samuel AT – Das 1. und 2. Buch der Chronik AT – Das 1. und 2. Buch der Könige AT – Das 1. und 2. Buch der Makkabäer AT – Das 2. Buch Mose (Exodus) AT – Das 3. Buch Mose (Levitikus) AT – Das 4. Buch Mose (Numeri) AT – Das 5. Buch Mose (Deuteronomium) AT – Das Buch Baruch AT – Das Buch Esra AT – Das Buch Ester AT – Das Buch Hiob (Ijob) AT – Das Buch Jesus Sirach AT – Das Buch Josua AT – Das Buch Judit AT – Das Buch Nehemia AT – Das Buch Rut AT – Das Buch Tobias (Tobit) AT – Das Buch der Richter AT – Das Hohelied Salomos AT – Der Prediger Salomo (Kohelet) AT – Der Prophet Amos AT – Der Prophet Daniel AT – Der Prophet Habakuk AT – Der Prophet Haggai AT – Der Prophet Hesekiel (Ezechiel) AT – Der Prophet Hosea AT – Der Prophet Jeremia AT – Der Prophet Jesaja AT – Der Prophet Joel AT – Der Prophet Jona AT – Der Prophet Maleachi AT – Der Prophet Micha AT – Der Prophet Nahum AT – Der Prophet Obadja AT – Der Prophet Sacharja AT – Der Prophet Zefanja AT – Der Psalter AT – Die Apokryphen AT – Die Klagelieder Jeremias AT – Die Sprüche Salomos (Sprichwörter) AT – Die Weisheit Salomos AT – Die poetischen Bücher AT – Die prophetischen Bücher Abdon Abed-Nego Abel Abel-Bet-Maacha Abel-Keramim Abel-Majim Abel-Mehola Abel-Schittim Abeln, Reinhard Abendlob Abendmahl Abendmahlssaal Abendmesse Aberglaube Abigajil Abimelech, Sohn von Gideon Abimelech, der König Abinadab Abiram Abischag Abischai Abjatar Ablass Abner Abraham Abrahams Großfamilie (Stammbaum) Abrona Abschalom Absolution Abt/Äbtissin Abtei Abtprimas Achan Ach du lieber Gott Achisch Achschaf Achsib Acht Achtundzwanzig Adada Adam Adama Adam bis Söhne Noachs (Stammbaum) Adami-Nekeb Adam und Eva Adasa Addar Adida Aditajim Adler Adma Adoni-Besek Adoni-Zedek Adonija Adora Adorajim Adramyttion Adullam Advent Adventskalender Adventskranz Adventswurzel Afek Afeka Affe Afik Agabus Agape Agende Agnus Dei Agrippa I. Agrippa II. Ahab Ahaschwerosch Ahasver Ahija Ahimaaz Ahimelech Ahinoam Ahitofel Ai Aja Ajalon Ajin Akazie Akelei Akklamation Akko Alammelech Alant Albe Alema Alemet Alexander der Große Alexandria Alle Jubeljahre einmal Alles Gute kommt von oben. Alles zu seiner Zeit Allgemeines Priestertum Almabtrieb Almon Almon-Diblatajema Almosen Aloe Alpha Alpha und Omega (A und O) Alraune Altar Altarbibel Altes Testament (AT) Altkatholische Kirche Altschul, Richard Alt und grau werden Alt wie Methusalem Aluminiumhochzeit Alusch Amad Amalek Amalekiter Amam Amasa Amberbaum Ambo Ambrosia Ameisen Amen Ammoniter Amnon Amoriter Amos Amphipolis Amrafel Amt Amulett Anab Anahara Anak Anamnese Ananeja Anastasiakreuz Anatot Anbetung Andacht Andorn Andreas Anem Anemone Angelus-Gebet Anglikanische Kirche Angst und Bange werden Anim Anis Anker Anliegen-Sonntag Anna An seine Brust schlagen / sich an die Brust klopfen Antependium Antilope Antiochia Antiochien Antipas Antipatris Antiphon Antisemitismus Antwortpsalm Apfel / Apfelbaum Apokalypse Apokryphen Apollonia Apollos Apostel Apostelfeste Apostelgeschichte Apostolikum Apostolische Sukzession Aquila und Priszilla Aquin, Thomas von Ar Ar-Moab Arab Arad Arados Arbatta Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Arche Archelaus Ariel Arimathäa Aristarch Arm Arme Seelen Armenische Apostolische Kirche Arnika Aron Aronstab Aroër Arpad Arrubot Artaxerxes Aruma Arward Asael Asarja Aschan Aschdod Asche Aschenkreuz Ascher Aschermittwoch Aschkelon Aschna Aschtarot Aschtarot-Karnajim Aseka Asenat Askalon Askese Asmawet Asnot-Tabor Aspis Assisi, Clara von Assisi, Franz von Assistenz Assos Assyrien Asyl Atach Atalja Atarot Atem Atheismus Athen Atrot-Addar Atrot-Bet-Joab Atrot-Schofan Attalia Auerochse Auf Herbergssuche gehen / sein Auf Herz und Nieren prüfen Auf Sand bauen – Auf Sand gebaut haben Auf Treu und Glauben Auf einen / keinen grünen Zweig kommen Auferstehung Auffahrt Aufklärung Auf schwachen Füßen stehen Auge Auge um Auge, Zahn um Zahn Augsburger Bekenntnis Augustinus Aureole Aus / Ohne Gnade und Barmherzigkeit Aus allen Wolken fallen Aus einem Saulus zum Paulus werden Aussegnung Aus seinem Herzen keine Mördergrube machen Ave Maria Avila, Theresa von Awa Awim Awit Azmon Azotos Ägag Ägypten Älteste Äneas Änon
-
B
Baal Baal-Gad Baal-Hamon Baal-Hazor Baal-Hermon Baal-Meon Baal-Pegor Baal-Perazim Baal-Tamar Baal-Zefon Baala Baalat Baalat-Beer Baana Babel Babel, Turmbau von Babylon Babylonisches Sprachengewirr Bach, Johann Sebastian Bachbunge Bachweide Bagoas Bahlinger, Stefanie Bahnlesung Bahurim Baitogabris Balaam Balak Baldrian Balsam Bamot Bamot-Baal Baptisten Bar-Mitzwa Barabbas Barak Barbarazweig Barea Barjesus Barmer Theologische Erklärung Barmherzigkeit Barnabas Barsabbas Barsillai Barth, Karl Bartholomäus Bartimäus Baruch Basilikum Basilisk Basisgemeinden Baskama Batomestajim Batseba Baum Baum der Erkenntnis Baum des Lebens Baumkreuz Baumwolle Bealot Bebai Becher Beckers, Jürgen Beer Beer-Elim Beer-Lahai-Roi Beerot Beerot-Bene-Jaakan Beerscheba Beeschtera Beffchen Befreiungstheologie Bei Adam und Eva anfangen Bei Gott ist kein Ding unmöglich Beichte Beifuß Beim Jüngsten Gericht – Am jüngsten Tag Beinwell Bekehrung Bekennende Kirche Bekenntnis Bel Bela Belmain Belschazzar Ben-Ammi Ben-Hadad Ben-Hadad, Opfer von Hasael Ben-Hadad, Sohn von Hasael Benaja Bene-Berak Bene-Jaakan Benedictus Benediktenkraut Benediktionale Benjamin Benjaminiter Beon Bered Berenike Berg Bergpredigt Berota Berotai Bertram Beröa Besek Besser arm und gesund als reich und krank Besser in die Hände Gottes fallen als in die Hände der Menschen Bestattung Bet-Anat Bet-Anot Bet-Araba Bet-Arbeel Bet-Aschbea Bet-Asmawet Bet-Awen Bet-Baal-Meon Bet-Bara Bet-Basi Bet-Biri Bet-Dagon Bet-Diblatajim Bet-Eden Bet-Eked-Roïm Bet-El Bet-Emek Bet-Ezel Bet-Gader Bet-Gamul Bet-Gan Bet-Gilgal Bet-Hanan Bet-Haram Bet-Hogla Bet-Horon Bet-Jeschimot Bet-Kar Bet-Kerem Bet-Leafra Bet-Lebaot Bet-Markabot Bet-Meon Bet-Nimra Bet-Pazzez Bet-Pegor Bet-Pelet Bet-Rafa Bet-Rehob Bet-Sacharja Bet-Sajit Bet-Schean Bet-Schemesch Bet-Schitta Bet-Tappuach Bet-Zur Betane Beten Betfage Bethanien Bethel Bethlehem Betonie Betonim Betsaida Betuel Betulia Bezalel Bezer Bibel Bibelübersetzung Biblische Stätten im Heiligen Land Biene Bienenkorb Bildad Bileam Bilha Bingen, Hildegard von Bin ich der Hüter meines Bruders? Binse Bis an das Ende der Welt Bis an die Enden der Erde Bischof bzw. Bischöfin Bischofsstab Bis hierher und nicht weiter Bistum Bitttage Blasiussegen Blatt Blau Blei Bleibe bei uns, denn es will Abend werden Bleibe im Lande und nähre dich redlich Blindheit Blitz Blume Blut Blutegel Blut und Wasser schwitzen Boas Bochim Bock Bodelschwingh, Friedrich von Bohne Bohnenkraut Bonhoeffer, Dietrich Bor-Aschan Bor-Sira Bora, Katharina von Borretsch Bosmans, Phil Bosor Bosora Bozkat Bozra Braut / Bräutigam Brautexamen Brautkleid Brautstrauß Bremse Brennnessel Brevier Brief und Siegel auf etwas geben Brombeere Brot Brotschrank Brotsegnung Bruderschaft Brunnen Brunnenkresse Buch Buche Buchsbaum Buchstabe Bulle Bundeslade Burg Bus Buttnmandl Buße Buße tun Bußgottesdienst Bußsakrament Byblos Bär Bärlauch Böses mit Bösem vergelten Böses mit Gutem vergelten
-
C
CVJM Calvin, Johannes (Jean) Canticum Cantz, Guido Caritas Chagall, Marc Chaldäer Chamäleon Charax Charisma Charismatische Bewegung Charta Oecumenica Chassidismus Chelus Cherub Choba Chor Choral Chorazin Chrisam Chrisammesse Christ(us)dorn (syrischer) Christ/Christin Christbaum Christblock Christbrand Christfest Christkind Christklotz Christmette Christologie Christstollen Christus Pantokrator Christusmonogramm (XP) Christvesper Chus Circumdederunt Clairvaux, Bernhard von Claudius, Matthias Colakraut (Eberraute) Commune-Texte Confiteor Currykraut Cäsarea Cäsarea Philippi
-
D
Dabbeschet Dalila Dalmatik Damaris Damaskus Dan Dan, Sohn Jakobs Daniel Daniter Dankaltar Danksagung Dank sei Gott Danna Daphne Darstellung des Herrn Das A und O (einer Sache) sein Das Land, wo Milch und Honig fließt Das Licht scheuen Das Salz der Erde sein Das eine tun und das andere nicht lassen Das geknickte Rohr nicht brechen, den glimmenden Docht nicht löschen Das ist mir zu hoch. Das liegt mir völlig fern. Das schwarze Schaf der Familie sein Datan Datema Datteln / Dattelpalme Da verließen sie ihn David Davidstern Deberat Debir Debora Deesis Dekan/In Dekanatssynode Delila Delphin Dem Kaiser geben, was des Kaisers ist Demas Demetrius Dem schnöden Mammon dienen Den Gerechten gibt’s der Herr im Schlaf Den Himmel offen sehen Den Kopf hängen lassen Den Schlaf des Gerechten schlafen Den Splitter im fremden Auge, aber den Balken im eigenen Auge nicht sehen Den Teufel durch Beelzebub austreiben Den alten Adam ausziehen Den bitteren Kelch bis zu Ende trinken Den ersten Stein auf jemanden werfen Den guten Kampf führen Deppe, Gertrud Der Abschaum der Menschheit Der Buchstabe tötet Der Dinge warten, die da kommen sollen Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Der Glaube kann Berge versetzen Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Der Himmel öffnet seine Schleusen oder Die Schleusen des Himmels öffnen sich. Der Kelch ist an jemandem vorübergegangen Der Mensch denkt und Gott lenkt Der Mensch lebt nicht vom Brot allein Der Prophet gilt nichts im eigenen Land Der Rest ist für die Gottlosen Der Schlüssel der Erkenntnis Der Stein des Anstoßes Der Teufel ist los Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Der Wein erfreut des Menschen Herz. Derbe Der verlorene Sohn Derwahl, Freddy Des Menschen Wille ist sein Himmelreich Dessau Deuterokanonische Schriften Deutsche Christen Devotionalie Di-Sahab Diakon Diakonie Diakonisse Diaspora Dibon Dibon-Gad Die Ersten werden die Letzten sein Die Habsucht ist die Wurzel allen Übels. Die Hand möge verdorren! Die Rache ist mein Die Schafe von den Böcken scheiden Die Spreu vom Weizen trennen Die Zeichen der Zeit nicht deuten können Die fetten Jahre sind vorbei. Die fetten und die mageren Jahre Dies irae Dilan Dill Dimissoriale Dimna Dimon Dimona Dina Dinhaba Dinkel Dionysius Diptam Direktorium Dispens Distel Diözesankalender Diözese Dobrick-Kroeber, Helga Doeg Dofka Dogma Dogmatik Dok Dom Dominikanerorden Donner Dor Dorkas Dorn Dornbusch Dornenkrone Dost Dotan Doxologie Drache Drei Dreieck Dreieinigkeitssymbol Dreikönigsspiele Dreizehn Drusilla Dscherasch Duma Durch Mark und Bein gehen Durch die Finger sehen Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden Dyckerhof, Peter D´Arc, Jeanne Dämon
-
E
EG Eben-Eser Ebez Ebron Edelsteine Eden Eder Edomiter Edreï Efes-Dammin Efeu Effata-Ritus Efraim Efraimiter Efrata Efron Eglajim Eglon Egrebel Ehe Ehering Eheversprechen Ehre, wem Ehre gebührt Ehrenamt Ehrenpreis Ehrfurcht Ehud Ei Eibisch Eiche Eidechse Ein Anathema sprechen (sein) Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert Ein Auge auf etwas werfen Ein Benjamin sein Ein Buch mit sieben Siegeln Ein Charisma haben Ein Engel sein Ein Gang durch das Gotteshaus Ein Geizhals sein Ein Gesundheits-Apostel sein Ein Goliath (Goliat) sein Ein Gräuel der Verwüstung sein Ein Herz und eine Seele sein Ein Herz von Stein haben Ein Idiot sein Ein Kainszeichen tragen Ein Kind des Todes sein Ein Kind dieser Welt sein Ein Kind unter dem Herzen tragen Ein Land, wo Milch und Honig fließen Ein Lückenbüßer sein Ein Mann Gottes sein Ein Mann von Welt sein Ein Menetekel sein Ein Nimmer satt sein Ein Nimrod sein – Ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn sein Ein Pharisäer sein Ein Prediger in der Wüste sein Ein Sabbatjahr machen Ein Wolf im Schafspelz Ein barmherziger Samariter sein Eine Feuertaufe bestehen Eine Gabe Gottes oder eine Gottesgabe haben / erhalten Eine Hiobsbotschaft erhalten Eine Josefsehe führen Eine Jugendsünde begehen Eine Passion haben Eine Quelle sein Eine Sünde wider den Heiligen Geist begehen Eine Unterlassungssünde begehen Eine Wohltat vergelten oder Gutes vergelten Eine große Kluft Eine kostbare Perle sein Ein ellenlanger Brief Einem die Augen für etwas öffnen Einen Adamsapfel haben Einen Heidenlärm machen Einen Kahlkopf haben Einen Mohren weiß waschen wollen Ein falscher Prophet sein Ein gutes Werk tun Einhorn Ein keuscher Josef sein Ein langer Laban Ein reines gutes Gewissen haben Eins Ein salomonisches Urteil fällen Ein schlechtes Gewissen haben – Gewissensbisse haben Einsetzungsbericht Einunddreißig Einundzwanzig Ein ungläubiger Thomas Ein verlorenes Schaf sein Ein wunderlicher Heiliger Einzug-Auszug Ein zweischneidiges Schwert sein Eisen Eisenkraut Eisvogel Eitel sein Ekbatana Ekdippa Ekklesia Ekron Ekstase El-Paran Elale Elam Elasa Elat Eleasar Elef Elefant Elemente Elevation Elf Elfenbeinturm Eli Elia Elieser Elifas Elihu Elija Elim Elimelech Elisabeth Elischa Elkosch Elon Elteke Eltekon Eltolad Elymas Embolismus Emek-Keziz Emeritierung Emmaus Emmausjünger En-Dor En-Eglajim En-Gannim En-Gedi En-Hadda En-Hazor En-Kore En-Mischpat En-Rimmon En-Rogel En-Schemesch En-Tappuach Enajim Enam Engel Engelamt Engelfeste Engelwurz Entlassung Enzian Enzyklika Epaphras Epaphroditus Ephesus Epiklese Epiphanie Epistel Erdbeere Erde Erech Eremitentum Erlöserkirche Erlösung Ernte Erntedank Erntekranz Erntekrone Erstkommunion Erzbischof Erzeltern Erzengel Eröffnung Esau Eschan Eschatologie Eschtaol Eschtemoa Esek Esel Es genug sein lassen Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Es herrscht ein Tohuwabohu. Es ist Krethi und Plethi beisammen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei Es ist nichts dahinter Esoterik Esra Essener Ester Estomihi Estragon Et-Kazin Etam Eter Ethik Ethnarch Etimasie Etwas ausposaunen Etwas drehen und wenden, wie man’s braucht Etwas für ein Linsengericht hergeben Etwas im Schweiße seines Angesichtes tun Etwas ist Vergeben und Vergessen Etwas vergelten Etwas wie seinen Augapfel hüten Eucharistie Eucharistieverehrung Eule Euphrat Eutychus Eva Evangeliar Evangelisation/Evangelisierung Evangelisch Evangelische Akademie Evangelische Allianz Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) Evangelisten Evangelisten-Symbole Evangelium Ewiges Gebet Ewigkeit Ewigkeitssonntag Exarch Exaudi Exegese (Bibelwissenschaft) Exerzitien Exkommunikation, Bann Exodus Exorzismus Exsultet Exsurge Ezechiel Ezem Ezjon-Geber erkennen
-
F
Fahne Falke Familienmesse Faraton Fasten Fastentuch Fegefeuer Feidmann, Giora Feige (echte) / Feigenbaum Feindesliebe Felix Felsen Fenchel Festum Festung Festus Feuer Feurige Kohlen auf jemandes Haupt sammeln Fichte Firmung Fisch (Ichthys) Fischer, Anne Flachs (Lein) Flamme Fledermaus Fliege Flockenblume Floh Flohsamen Fluss Fluten Forum Appii Francke, August Hermann Frau(en)tragen Frauen (feministische Theologie) Frauenmantel Frauenschuh Freikirche Friedensdekade Friedensgruß Friedfertig sein Friedhof Fritsch, Marlene Fronleichnam Frosch Frucht Frömmigkeit Fuchs Fundamentalismus Fuß Fünf Fünfzehn Fünfzig Fürbitte
-
G
Gaba Gabbai Gabenbereitung Gabengebet Gabriel (Erzengel) Gad Gadara Galgant Gallim Gallio Gamala Gamaliel Garten Garten Eden Gasa Gat Gat-Hefer Gat-Rimmon Gaudete Gazara Gazelle Geba Gebal Geben ist seliger als nehmen Gebet Gebetseinladung Gebetsschnur Gebim Gebote Gedalja Gedenktage Geder Gedera Gederot Gederotajim Gedor Gedächtnis Gefäß Gegen den Strom schwimmen Gegenwart Christi Gehasi Geier Geist Geißblatt Gelb Gelilot Gelübde Gemeinde Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) Gemeinschaft der Heiligen Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten Gemeinschaftsbewegung Generalkalender Genesis Genezareth Gennesaret Genua, Katharina von Gerar Gerasa Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung Gerhardt, Paul Gerste Gesang Gesangbuch Geser Gesetz Gethsemane (Garten) Getreu bis in den Tod Gewürznelke Gewürzrohr Giach Gibbeton Gibea Gibeat-Elohim Gibeon Gideon Gidom Gift und Galle spucken Gilgal Gilo Gimso Ginaë Ginster Gittajim Glaube Glaubensbekenntnis, Credo Gleichnisse Glocken Gloria Gloria in excelsis Deo Gnadauer Gemeinschaftswerk Gnade Gnadengaben Gnadenjahr Gnadenstuhl Goebel, Jonas Gog und Magog Golan Gold Goldenes Kalb Golgota Goliat Gomer Gomorra Gophna Gorschen Gortyna Gott Gott befohlen! Gottesdienst Gottesdiensthelfer/in Gotteslob Gotthelf, Jeremias Gott lässt seiner nicht spotten Gott mit uns / Gott sei mit jemandem Gott sei (jemandem) gnädig Gott sei Dank Gottverlassen sein Grabdenkmal Grablegung Gral Granatapfel Gras Grau Greif Grenzstadt Moabs Griechisch-orthodoxe Kirche Grosche, Erwin Grundmann, Kalle Gruppenmesse Gruß Grün Grün, Anselm Gründonnerstag Guardini, Romano Gula Gundelrebe Gundermann Gur-Baal Gurke Gustav II. Adolf Gut angeschrieben sein Guter Dinge sein Gänseblümchen Gänsefingerkraut Götzen Gürtel
-
H
Die Dynastie der Hasmonäer (Anfänge: Makkabäer) Haak, Rainer Haar Habakuk Habicht Habichtskraut Hadad Hadascha Hadassa Hadid Hafarajim Hafer Hagar Hagebutte Haggai Hahirot Hahn Hahne, Peter Halach Halhul Halikarness Halleluja Ham Haman Hamat Hamiten Hammat Hammer Hammon Hammot-Dor Hamona Hananias, Anhänger der Apostel Hananias, der Jünger Hananias der Hohenpriester Hand Hand- und Fußwaschung Handauflegen Handkommunion Handschuh Hanes Hanf Hanna Hanna, Mutter von Samuel Hanna, die Prophetin Hannas Hannaton Hanun Har-Heres Haran Harn Harod Haroschet-Gojim Hasael Haschmona Hase Hasmonäer Haussegnung Haustaufe Hauswurz Hawot-Jaïr Hazar-Addar Hazar-Enan Hazar-Gadda Hazar-Schual Hazar-Susa Hazarmawet Hazerot Hazezon-Tamar Hazor Hazor-Hadatta Heber Hebron Hebräer Hefer Heide Heiland Heilig Heilige Heilige Familie Heilige Schrift Heilige drei Könige Heiligenattribute Heiligenfeste Heiligenschein Heiliger Abend Heiliger Geist Heiliges Jahr Heiliges Land Heiliggeistloch Heiligstes Herz Jesu Heilsarmee Heinemann, Gustav Heinrich Haus Helam Helba Helbon Helef Heliopolis Helkat Helmkraut Hennastrauch Henoch Hephata Herbergssuche Hermelin Herodes Herodes der Große Herodes und seine Dynastie (Stammbaum) Herodias Herodion Herrnhuter Brüdergemeine Herz Herz-Jesu-Verehrung Herzzerreißend sein oder Jemandem das Herz zerreißen Heschbon Heschmon Hesekiel Hetiter Heu Heuschrecke Hexagramm Hezron Hierapolis Hier lasst uns Hütten bauen! Hilkija Himmel Himmelfahrt Himmelfahrtskränzchen Himmelsbrot Himmel und Hölle in Bewegung setzen Hiob Hiobsbotschaft Hippos Hiram Hirsch Hirschzunge Hirse Hirte Hiskija Hochamt Hochfest Hochgebet Hochmut kommt vor dem Fall. Hochzeit Hochzeitsbitter Hochzeitskerze Hochzeitskleid Hoffsümmer, Willi Hofni Hohepriester Hoher Rat Holofernes Holon Holunder Homilie Hopfen Hor-Gidgad Horem Horen Horescha Horma Horn Hornisse Horonajim Hosa Hosanna Hosea Hosianna Hostie Huflattich Hugenotten Huhn Hukkok Hulda Humta Hund Hundert Hundertfältige Frucht hervorbringen Hungertuch Hur Huschai Hymnus Hyrkania Hyäne Händel, Georg Friedrich Häresie Höhengänge Höhle Hölle
-
I
INRI Ibis Igel Ije-Abarim Ijim Ijob Ijon Ikabod Ikone Ikonion Im Adamskostüm Im Dunkeln tappen Im Kleinen treu sein Immanuel Immer Immergrün Improperien Im siebten Himmel sein In Gottes Hand In Sack und Asche gehen In Teufels Küche kommen In alle Winde zerstreut In alle vier Winde In den Himmel kommen In den Ohren gellen In den Wind reden In den letzten Zügen liegen In die Bresche springen Ingwer In jemandes Fußstapfen treten Inkarnation Innere Mission Inquisition Ins himmlische Jerusalem gelangen Interdikt Interreligiöser Dialog Introitus Invitatorium Invocavit Ir-Melach Ir-Nahasch Ir-Schemesch Isaak Isai Isana Ischbaal Isebel Islam Ismael Ismaeliter Israel Issacher Iwa
-
J
Die Kinder Israels (= Jakobs) Jabal Jabesch Jabesch-Gilead Jabez Jabin Jabne Jabneel Jael Jafet Jafia Jafo (Joppe/Jaffa) Jagd Jagur Jahaz Jahreslosung Jahreszeiten Jahrgedächtnis Jahwe Jakob Jakobus, Sohn von Alphäus Jakobus der Kleine Jakobus der Ältere Jamnia Jamnia, Hafen von Janoach Janum Jarmut Jaser Jason Jaspis Jattir JaÏrus Jebus Jebusiter Jedes Wort (etwas / alles) auf die Goldwaage legen Jehu, der König Jehu, der Prophet Jehud Jemand die Leviten lesen Jemandem Grenzen setzen Jemandem das Leben schwer machen Jemandem das Maul stopfen Jemandem ein Dorn im Auge sein Jemandem fällt es wie Schuppen von den Augen Jemandem geht ein Licht auf Jemandem mit Rat und Tat zur Seite stehen Jemandem nach dem Leben trachten Jemandem sein Herz ausschütten Jemandem stehen die Haare zu Berge Jemandem steht das Wasser bis zum Halse Jemanden als Lockvogel einsetzen Jemanden auf Händen tragen Jemanden einen Denkzettel verpassen Jemanden in der Hand haben Jemanden in die Wüste schicken Jemanden oder etwas an seinen Früchten erkennen Jemanden oder etwas bis in den Himmel heben/erheben Jemanden sitzen lassen Jemanden unter seine Fittiche nehmen Jemanden verleugnen Jemanden von Pontius zu Pilatus schicken Jemanden zum Sündenbock machen Jemandes Segen haben Jemandes Typ sein – Nicht jemandes Typ sein Jemima Jeremia Jericho Jerobeam Jerusalem Jesaja Jeschana Jeschua Jesreel Jesse Jesuitenorden Jesus, Sohn von Sirach Jesus Christus Jesus Trigramm (IHS) Jesus von Nazareth Jibleam Jidala Jiftach Jiron Jirpeel Jitla Jitnan Jitro Joab Jogboha Johannes Johannes, der Apostel Johannes, der Verfasser der Offenbarung Johannes Markus Johannes der Evangelist Johannes der Täufer Johannisbad Johannisbrotbaum Johannisfeuer Johanniskraut Johannistag Johannistau Johanniswein Jojada Jokdeam Jokeneam Jokmeam Jokteel Jona Jonadab Jonatan, Sohn von Saul Jonatan, der David diente Jonatan, der Makkabäer Joppe Jordan Jorkoam Joschafat Joschija Josef, der Sohn von Jakob Josef, der Verlobte Marias Josef Barsabbas Josef aus Arimathäa Joses Josua Jotabata Jotba Jotbata Joël Jubal Jubeljahr Jubilate Juda Judaistik, Altorientalistik Judas Judas, ein Bruder Jesu Judas Barsabbas Judas Iskariot Judasbaum Judas der Makkabäer Judentum Judica Judit Judäa Jugendgottesdienst Julius Jungen Wein in alte Schläuche füllen Jungfrau Jungfrauengeburt Jungfrauenweihe Junia Justus Jutta Jämmerlich umkommen oder Jämmerlich ums Leben kommen Jünger Jüngstes Gericht
-
K
Die Könige von Juda und Israel (Stammbaum) Kabbala Kabbon Kabul Kabzeel Kadesch Kadesch-Barnea Kafar-Salama Kafarnaum Kafnata Kaim Kain Kain und Abel Kajaphas Kalb Kaleb Kalmus Kalne Kalno Kalói Linénes Kamel / Dromedar Kamille Kamon Kanaan Kanaan, Sohn von Harn Kana in Galiläa Kanatha Kandake Kanne Kanon Kantate Kantillation Kantor/Kantorei Kanzel Kapelle Kapernstrauch Kaplan Kapuze Kapuzinerkresse Kardinal Kardinalstugenden Karfreitag Karka Karkemisch Karkor Karmel (Berg) Karnajim Karsamstag Karta Kartan Karwoche Kasel Kasifja Kaspin Kasualien Katakomben Katechet/Katechetin Katechismus Katechumenat Kathedra Kathedrale Katholisch Kattat Kauda Kedemot Kedesch Kefar-Ammoni Kefas Kefira Kehelata Kehrvers Keinen Stein auf dem andern lassen Kelach Kelch (Ciborium) Kelchkommunion Kelly, Maite Star Kenat Kenchreai Kerbel Kerijot Kerijot-Herzon Kerkeling, Hape Kerub Kerze Kesalon Kesib Kesil Kesullot Kette Ketura Ketzer Keuschheit Keïla Kibzajim Kichererbse Kidron Kiefer Kilmad Kina Kind Kindelwiegen Kindersegnung Kinder und Kindeskinder King, Martin Luther Kinneret Kir Kir-Haraset Kir-Heres Kirche Kirchenfenster Kirchengemeinderat Kirchengestühl Kirchenjahr Kirchenjahreskreis Kirchenkampf Kirchenmusik Kirchenschiff Kirchenspaltung (Schisma) Kirchensteuer Kirchentag Kirchenvorstand Kirchenväter Kirchgeld Kirchturm Kirchweih Kirjat-Arba Kirjat-Baal Kirjat-Huzot Kirjat-Jearim Kirjat-Sanna Kirjat-Sefer Kirjatajim Kirschblüte Kirsche Kisch Kischjon Kislot-Tabor Kitlisch Kitron Klagelied Klagemauer Klarissen Klatsch-Mohn Klaudius Lysias Klausen Klee Kleidung Kleopas Klepper, Jochen Klerus Klippschliefer Kloster Klug (listig) wie die Schlange Knidos Knien Knoblauch Kobra / Natter Kohelet Kollekte Koloquinte Kolossai Komet Kommemoration Kommunion Kommunionanzug Kommuniongesang Kommunionhelfer/in Kommunionkerze Kommunionkleid Komplet Konfession Konfirmation Konklave Konkordanz Konsekration Konstantin Konzelebration Konzil Kopten Korach Koralle Koriander Korinth Kormoran Kornblume Kornelius Korporale Kort, Kees de Kos Kosbi Koseba Krankenkommunion Krankensalbung Krank vor Liebe sein Kranz Krebs Kredenz Kreuz Kreuzabnahme Kreuzerhöhung Kreuziger, Elisabeth Kreuzigung Kreuztragung Kreuzverehrung Kreuzverhüllung Kreuzweg Kreuzzeichen Kreuzzüge Krippe Krippenspiele Krispus Kristall Krokodil Krone Kronenwucherblume Krug Krumme Wege gehen Kruzifix Krypta Krähe Kräutersegnung oder Kräuterweihe Kubebe Kulte Kun Kuppel Kurie Kurrende Kurz, Gertrud Kuschiter Kuss Kuta Kutte Kyamon Kyrene Kyrie eleison Kyrus II. der Große Käßmann, Margot Köder, Sieger Könige Israels Königin von Saba Königskerze Königsweg Kümmel Kürbis Küstenmacher, Werner "Tiki" Küster/in
-
L
Laban Labyrinth Lachisch Lachmas Laetare Laie Lajescha Lajisch Lakkum Lamech, Nachkomme von Kain Lamech, Nachkomme von Set Lamm / Schaf Lampe Landeskirche Landeskirchenamt Lanze Lasset die Kindlein zu mir kommen! Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot Laubhüttenfest Laubhüttenfest / Sukkot Lauch Laudes Lavendel Lazarus, der Bettler Lazarus, der Bruder von Martha Lea Lebaot Lebensrute Leben wie die Lilien auf dem Felde Leberblümchen Lebona Lecha Ledigkeitsnachweis Lehi Leichenschmaus Leiden Leier Lein Leiter Lektionar Lektor/in Lerche Lescha Leschem Lesehore Lesejahr Leseordnung Lesepult Lesung Lettner Leuchter Leuenberger Konkordie Levi, Sohn Jakobs Levi, Sohn von Alphäus Leviathan Leviten Libna Licht Lichtnelke Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne End Liebstöckel Lied Lilie Lima-Papier Linde Lindenberg, Udo Linse Litanei Liturgie Liturgie der Fastenzeit Liturgische Bücher Liturgische Farben Liturgische Feier Lo-Dabar Loadikeia Lob Gottes Lod Lohfink, Gerhard Longinus Lorbeer / Lorbeerbaum Losung Lot Lotos Loyola, lgnatius von Lucernar Luchs Luciabraut Luft Lukas Lumen Christi Lungenkraut Lus Luther, Martin Lutheraner Lutherische Orthodoxie Lutherischer Weltbund Luzifer Lydda Lystra Löwe Löwenzahn Lütz, Manfred
-
M
Maarat Machairous Machbena Made Madmanna Madmen Madmena Madon Magbisch Magdala Magdeburg, Mechthild von Magneteisenstein Magnificat Mahaleb Mahanajim Maiandacht Maiestas Domini Maiglöckchen Majoran Makaz Makhelot Makkabäer Makkeda Malchus Maleachi Mallus Malve Mamre Manahat Manasse Mandel / Mandelbaum Mandorla Mandragora Manna Manoach Mantel Maon Mara Marala Marescha Margarite Maria Maria, Mutter Jesu Maria Magdalena, Magdalena Maria aus Betanien Marienandachten Marienfeste Marisa Mariä Darstellung Mariä Himmelfahrt Markus Marot Martha Marti, Kurt Martin, Adam Martinifasten Martinsfest Martinsfeuer Martinsgans Martinshörnchen Masada Masreka Massa Mastixstrauch Mattana Mattatias Matthias Matthäus, der Apostel Matthäus, der Evangelist Matutin Maulbeerbaum Maultier Maus Meara Mechona Medeba Meditation Meer Meerrettich Meerstern Mefaat Mefiboschet Megiddo Mehola Mehr Schulden als Haare auf dem Kopf haben Mein Täubchen Meister Eckhart Meisterwurz Meißener Erklärung Melanchthon, Philipp Melchisedek Melde Melone Memphis Mennoniten Menora Mensch Menschensohn, Menschenkind Merab Merib-Baal Meriba Meribat-Kadesch Merom Meros Mesalot Meschach Mesner/in Messbuch (Missale) Messe, heilige Messe Messer Messgewand Messias Messstipendium Methodisten Methusalem Metropolit Mettenstock Metuschelach Meurer, Franz Meyer, Joyce Mezad-Hashavyahu Micha, Prophet (Buch) Micha, der Silberdieb Micha der Prophet Michael (Erzengel) Michaelistag Michaelsfeuer Michal Michler, Elli Michmas Michmetat Middin Midianiter Migdal-Eder Migdal-El Migdal-Gad Migdol Migron Milan Milch Milet Milka Mimose Ministrant (Messdiener) Minnit Minze Mirjam Mischal Misericordias Domini Misrefot-Majim Missio/Misereor Mission Missionar/in Mit Blindheit geschlagen sein Mit Engelszungen reden Mit Feuereifer Mit Furcht und Zittern Mit Glanz und Gloria Mit Heulen und Zähneknirschen Mit dem Leben davonkommen Mit dem Mantel der christlichen Nächstenliebe zudecken Mit etwas Schiffbruch leiden Mit etwas schwanger gehen Mit jemandem ins Gericht gehen Mitka Mitra Mit seinen Pfunden wuchern Mitte Mit verklärtem Blick Mitylene Mizpa Mizpe Mizpe-Moab Moab Moabiter Modeïn Mohn Molada Monarde Monatslosung Monstranz Mordechai Moreschet-Gat Morgengebet Morgenlob Morgenröte Morgenstern Morija (Berg) Mormonen Mose Moser Moserot Motte Moza Mozart, Wolfgang Amadeus Mund Muschel Muskatnuss Mutter Teresa (von Kalkutta) Mutterkraut Myndos Myra Myra, Nikolaus von Myrrhe Myrte Mystagoge/Mystagogin Mystagogie Mysterium Mystik Mädesüß Märtyrer Mönch Mönchsgewand Mönchspfeffer Möve Mühle Münster Müntzer, Thomas Münze
-
N
NT – Das Evangelium nach Johannes NT – Das Evangelium nach Lukas NT – Das Evangelium nach Markus NT – Das Evangelium nach Matthäus NT – Das prophetische Buch NT – Der 1., 2.und 3. Brief des Johannes NT – Der 1. Brief des Paulus an Timotheus NT – Der 1. Brief des Paulus an die Korinther NT – Der 1. Brief des Paulus an die Thessalonicher NT – Der 1. Brief des Petrus NT – Der 2. Brief des Paulus an Timotheus NT – Der 2. Brief des Paulus an die Korinther NT – Der 2. Brief des Paulus an die Thessalonicher NT – Der 2. Brief des Petrus NT – Der Brief an die Hebräer NT – Der Brief des Jakobus NT – Der Brief des Judas NT – Der Brief des Paulus an Philemon NT – Der Brief des Paulus an Titus NT – Der Brief des Paulus an die Epheser NT – Der Brief des Paulus an die Galater NT – Der Brief des Paulus an die Kolosser NT – Der Brief des Paulus an die Philipper NT – Der Brief des Paulus an die Römer NT – Die Apostelgeschichte des Lukas NT – Die Briefe NT – Die Offenbarung des Johannes NT – Die Pastoralbriefe Naama Naaman Naara Nabal Nabot Nach einer Pfeife tanzen Nach mir die Sintflut! Nacht Nachtfalter Nacktheit Nadabat Naemi Naftali Nahalal Nahaliël Nahalol Nahasch Nahor Nahum Nain Namenspatron / Patron Narde Narrative Theologie Narzisse Natan Natanael Nazareth Nea Neapolis Neara Neballat Nebo Nebukadnezzar Neftoach Negiël Nehemia Nelke Nelkenwurz Nest Netaim Netofa Netz Neuapostolische Kirche Neues Testament (NT) Neujahrsansingen Neun Neunundneunzig Nezib Nibschan Nicht ein Jota Nicht ganz koscher sein Nicht mehr wissen, wo rechts und wo links ist Nichts Neues unter der Sonne Nicht von dieser Welt sein Nicht von gestern sein Niemöller, Martin Niere Nikodemus Nikolausstiefel Nikopolis Nilpferd Nimra Nimrod Ninive Nizänum No Noach Nob Nobach Noha Nonne Noomi Nouwen, Henri Noviziat Null Nun hat die arme Seele Ruh. Nur ein Lippenbekenntnis ablegen Nursia, Benedikt von Nuss / Nussbaum Nussmärte Nysa Nächstenliebe Nötig wie das tägliche Brot
-
O
O-Antiphonen Obadja Ober/in Obot Ochse / Rind Oculi Odermennig Odollam Offenbarung Ofni Ofra Og Ohne Ansehen der Person Ohne Falsch sein Ohola und Oholiba Okina Okkurenz Oktav Olivenbaum Omri On Onager Onan Onesimus Ono Opfer Opfergang Opfermahl Opferstock Opfertier Oration Orchidee Orden Ordinarium / Gottesdienstordnung Ordination Ordo Missae Oregano Oresa Organist/in Orgel Oronaim Orthodoxe Kirchen Orthodoxie Orthosia Osterei Osterfestkreis Osterfeuer Ostergruß Osterhase Osterkerze Osterlachen Osterlamm Osterlicht Ostermahl Ostern Osternacht Osternest Osterrute Ostersamstag Ostkirche Ökumene Ökumenischer Gottesdienst Ökumenischer Rat Ölberg Ölbergandachten Öle, heilige Öl in die Wunden gießen
-
P
Pagu Pallium Palmarum Palme Palmenstadt Palmsonntag Palmzweig Palästina Paneas Panther Paphos Pappel Papst Papst Benedikt XVI. Papst Franziskus Papst Johannes Paul II. Papyron Papyrus Para Paradies Paraliturgie Paramente Partikel Pas-Dammim Pascha-Mysterium Passa Passion Passion Christi Patara Pate, Patin Patene Patriarch Patrozinium Paulus Paulus Sergius Pavian Pazifismus Pegai Pehel Pelikan Pella Pelusium Pelzmärte Pentagramm Penuel Perez-Usa Pergamon Perge Perikope Perle Perlen vor die Säue werfen Persepolis Petersilie Petor Petra Petrat, Dr. Nils Petri Heil Petrus Pfarrer/Pfarrerin, Pastor/Pastorin Pfarrgemeinderat Pfarrgottesdienst Pfau Pfefferminze Pferd Pfingsten Pfingstfeuer Pfingstkirchen Pfingstochse Pfingstrose Pforte Pfründe Pharaton Pharisäer Pharisäer, Sadduzäer, Zeloten, Essener Phasaelis Phaselis Philadelphia Philemon Philipp I. von Hessen Philippi Philippus, Tetrarch Philippus, der Apostel Philister Philoteria Phoinix Phöbe Phönix Phönizier Pi-Beset Pi-Hahirot Pietismus Pilatus Pileolus Pilger Pilgern & Pilgerwege Pimpinelle Pinhas, Sohn von Eleasar Pinhas, Sohn von Eli Pinie Piraton Pistazie Pitom Platane Pluviale Polarstern Pontifar Pontifikalamt Pontifikale Pontius Pilatus Portulak Preces Predigt Predigtlied Presbyterianische Kirchen Presbyterium Priester Priestersitz Prim Primiz Priszilla Privatmesse Profanierung Profess Prophet Proprium Propst Prostration Protestantismus Prozession Präfation Präfekt Prälat Präses Präsidalgebet Psalmen Psalter Ptolemaïs Publius Puffbohne Pul Pult Punon Purifikation Purpur Puteoli Pyxis Päpstlicher Segen
- Q
-
R
Rabba Rabbat-Ammon Rabbi Rabbit Rabe Rabschake Rad Rafael (Erzengel) Rafon Rages Rahab Rahel Rahner, Karl Rainfarn Rakkat Rakkon Rama Ramat-Mizpe Ramat-Negeb Ramat Matred Ramat Rahel Ramatajim Ramot Ramot-Gilead Ramses Raphia Ratte Rau, Johannes Raute Rebekka Rebhuhn Rechab, Abstinenzler Rechab, Truppenführer Rechtfertigung Rechts und links Reden ist Silber, Schweigen ist Gold Refidim Reformation Reformationstag Reformierte Kirchen Reformierter Weltbund Regenbogen Regionalkalender Regium Reguel Reh Rehabeam Rehob Rehobot Rehobot-Ir Reich Gottes Reiher Reinen Herzens sein Reisesegen Reiter Rekem Religion Religionsfreiheit Religionsunterricht Religionswissenschaft/Religionsgeschichte Religiöse Sondergemeinschaften Religiöse Sozialisten Reliquie Remet Reminiscere Requiem/Sterbeamt Resen Responsorium Retabel Rezef Rhode Rhodos Ribla Richter, Richterin Richtet nicht! Rimmon Rimmon-Perez Ring Ringelblume Rissa Ritma Rittersporn Rituale Romanum Ritus Rizinus Rizpa Rogate Roger, Frère Roggen Roglim Rohrdrommel Rom Rorate Rose Rosenkranz Rosenkranzmonat Rosine Rosmarin Rot Rotterdam, Erasmus von Ruben Rubrik Ruf vor dem Evangelium Ruge, Nina Ruhe finden Ruhe in Frieden! Ruma Russisch-orthodoxe Kirche Rut Rut und der Stamm Isais (Wurzel Jesse) Römisch-katholische Kirche
-
S
Sabbat Sabbatjahr Sacharja Sadduzäer Safran Sakrament Sakramentar Sakrarium Sakristei Salamis Salbei Salbung Salcha Salem Salim Salome, Mutter von Jakobus und Johannes Salome, Tochter von Herodias Salomo Salz Salzkraut Samaria Samarien Samariter Sampsame Samson Samuel Sanctus Sanduhr Sankt Kümmernis Sanktorale Sanoach Saphira Sara, Frau von Abraham Sara, Tochter von Raguel Sardes Sarepta Sarid Sauerampfer Sauerteig Saul Schaalbim Schaalbon Schaarajim Schadrach Schafgarbe Schafir Schahazajim Schakal Schale Schalom Schamir Scharon Scharuhen Schauerkerze Schebarim Schebna Schefam Scheideweg Schellenmärte Schema Scheschbazzar Schierling Schiff Schikkaron Schildkröte Schilfrohr Schilhim Schilo Schiloniter Schimi Schimron Schimron-Meron Schion Schischak Schisma Schittim Schlange Schleier Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst Schlussgebet Schlüssel Schlüsselblume Schmetterling Schnecke Schnee Schneeglöckchen Schnittlauch Schola Scholl, Sophie und Hans Schott Schriftlesung Schulammit Schuldbekenntnis Schunem Schunemiterinnen Schutzpatron Schwalbe Schwan Schwarz, Andrea Schweden, Birgitta von Schwein / Wildschwein Schwert Schwerter zu Pflugscharen schmieden Schwertlilie Schwestern und Brüder Schwikart, Georg Schädel Schöllkraut Schöpfung Sebaste Sebulon Sechacha Sechs Sechshundertsechsundsechzig Sechsunddreißig Sedile Seele Seelsorge Seelsorger/in Sefar Sefarad Sefarwajim Sefat-Abel-Mehola Segen Segnung und Weihe Sei ein Mann! Sein (sanftes) Joch auf sich nehmen Sein Golgatha (Golgota) erleben Sein Herz auf der Zunge tragen Sein Kreuz tragen – Sein Kreuz auf sich nehmen Sein Licht unter den Scheffel stellen Sein Mütchen an jemanden kühlen Sein Scherflein beisteuern Seine Hoffnung auf jemand oder etwas setzen Seine Hände in Unschuld waschen Seine Zunge im Zaum halten Sein eigen Fleisch und Blut Seinem Stern folgen Seinen Geist aufgeben Seinen Katechismus kennen Seinen Mund nicht aufmachen Seinen Tag von Damaskus erleben Seinen letzten Heller weggeben Seit Adams Zeiten Sekte Sela Seleukeia Selig Sellerie Sem Semiten Senf (schwarzer) Sennabusch Sepphoris Septuagesimae Sequenz Seraph Sergius Paulus Serubbabel Set Sexagesimae Sext Sibma Sibrajim Sich die Augen ausweinen Sich die Haare raufen Sich einen Namen machen Sichelhenke Sichem Sichemiten Sich etwas zu Herzen nehmen Sich etwas über den Kopf wachsen lassen Sich in sein stilles Kämmerlein zurückziehen – Im stillen Kämmerlein beten Sich nach den Fleischtöpfen Ägyptens (zurück-)sehnen Side Sidon Sieb Sieben Siebenunddreißig Siebzig Siegel Siena, Katharina von Sif Sifmot Sifron Sihon Sikyon Silas Silber Silpa Simeon, Mann aus Jerusalem Simeon, Sohn von Jakob Simeon, der Makkabäer Simon Simon, Bruder Jesu Simon, der Zauberer Simon der Aussätzige Simon der Gerber Simon der Zelot Simon von Zyrene Simri, König Israels Simri, aus dem Stamm Simeon Simson Sinai (Berg) Sintflut Sira Sisera Sitzen Skorpion Skytopolis Smaragd Smyrna Socho Sodom Sodom und Gomorra (Redewendung) Sonne Sonnenblume Sonnenwende Sonntag Sosthenes So zahlreich wie Sand am Meer Spangenberg, Peter Sparta Spatz Specht Speisesegnung / Speisenweihe Spekulatius Spener, Jacob Philipp Sperber Spierstaude Spilling-Nöker, Christa Spinne Spiritualität Stab Stab des Moses Stadt Stammbäume der Bibel Statio Stationsliturgie Staub Stechmücke Stehen Stein Stein, Edith Steinbock Steinbrech Steinhuhn Steinkauz Stephanus Sterne Sternsinger Stieglitz Stier Stille Stola Stolgebühren Storch Stratons Turm Strauß Strohschab Stubenspiele Stundenbuch Stundengebet Stutenfrau Stutz, Pierre Styrax (Amberbaum) Stämme Israels Subsidiarität Sukkot Superintendent Sur Susa Susanna Suttner, Bertha von Sychar Syene Sykomore Symbol Synagoge Synkretismus Synode Synoptiker Syrakus Syrien Systematische Theologie Säkularisierung Sänger/Sängerin Säule Sölle, Dorothee Sünde Sündenbock Süßholz
-
T
Taanach Taanat-Schilo Tabbat Tabera Tabernakel Tabita Tabor Tachpanhes Tadmor Tagesgebet Tagesheilige Tageslosung Tagzeitengebet Tagzeitenliturgie Tahat Taizé Talar Talent haben Tamar Tamar, Schwiegertochter von Juda Tamariske Tanne Tanz Tappuach Tarala Taricheai Tarmar, Tochter von David Tarsus Taube Tauben Ohren predigen Taubnessel Taufbecken Taufe Taufe des Herrn Tauferinnerung Taufkerze Taufkleid Taufspruch Taufstein Taufsymbole Taufversprechen Taufwasser Taufzeuge, Taufzeugin Tausend Tausendgüldenkraut Te Deum laudamus Tebach Tebez Tefon Tekoa Tel-Abib Tel-Harscha Tel-Melach Telaim Telassar Telem Tempel Tempelplatz Temporale Terach Terebinthe Tertullus Terwitte, Bruder Paulus Terz Testament Tetraktys Tetramorph Teufel Thaddäus Thamna Theben Theodizee Theologe/Theologin Theologie Theophilus Thessalonich Thomas Thomasevangelium Thron Thyatria Thymian Thyrsosstab Thüringen, Elisabeth von Tiberias Tibhat Tiere Tifsach Tiglat-Pileser III. Timna Timnat-Heres Timnat-Serach Timotheus Tirza Tischbe Tischgebet Titius Justus Titus Tobias Tobit Tochen Tod Todsünde Tolad Toleranz Tora Totenbrett Totengedenken (Sechswochenamt & Jahrgedächtnis) Totenglocke Totenoffizium Totes Meer Tours, Martin von Tradition Tragant Traube Traubekenntnis Trauerbegleitung Trauermette Traufrage Trauspruch Trauung Tres-Tabernae Tridentinische Messe Triduum sacrum Trinitatis Trinitatiskreis Trinität (Dreifaltigkeit) Tripolis Trishagion Troas Tubal-Kajin Tulpe Turm Turmspitze Turmuhr Tychikus Tyrus Täufer, Wiedertäufer Türe
- U
-
V
Vaterunser Vatikan, Vatikanstaat Vatikanum Veilchen Velum Vereinigte Evangelisch-lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) Vergebung Vergelt's Gott! Verkündigung Verlobung Vermählung Verneigung Verraten und verkauft sein Versikel Versuchung Vesper Via dolorosa (Kreuzweg Jesu) Viele Worte machen – Nicht viele Worte machen Viele sind berufen, aber nur wenige auserwählt Vier Vierundzwanzig Vierzehn Vierzig Vigil Vikar Violett Viper Visitation Vogelmiere Volksaltar Volksfrömmigkeit Volksgesang Volkskirche Volksmessbuch Voll des süßen Weines sein Vom Scheitel bis zur Sohle Von Adam und Eva stammen Von Angesicht zu Angesicht Von Gottes Gnaden Von den Dächern predigen Vor jemandem Auge Gnade finden Vorlage Pflanzen Vormesse Votivmesse Vujicic, Nicholas James „Nick“ Vulgata Vögel
-
W
Waage Wacholder Wachtel Waffen Waid Wal Waldenser Waldmeister Wall- /Pilgerfahrt Wallfahrt & Wallfahrtsorte Walnuss Wandlung Waran Waschti Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu! Was du tun willst, das tue bald Was ich geschrieben habe, bleibt geschrieben Was ist das für so viele? Wasser Was werden wir essen, was werden wir trinken? Was wird aus diesem Kindlein werden? Weber, Margarete Weder warm noch kalt sein Wegerich Wegwarte Weide Weihe Weihesakrament Weihnachten Weihnachtsbaum Weihnachtsfestkreis Weihnachtsgebäck Weihnachtsgeschichte Weihnachtskrippe Weihnachtslieder Weihnachtsoktav Weihrauch Weihrauchfass Weihwasser Weil, Simone Weimer, Wolfram Wein Weinraute Weinstock Weizen & Gerste Weizsäcker, Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weiß Weißdorn Weltachse Wengenroth, Ute Wenig, aber von Herzen Wenn / So Gott will Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder Wer Ohren hat zu hören, der höre! Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wermut (Absinth) Wer nie sein Brot mit Tränen aß Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden - wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wer suchet, der findet Wer’s glaubt, wird selig Wes Geistes Kind jemand ist Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Wespe Wetterkerze Wettersegen Weyer, Johann Dr. Wichern, Johann Hinrich Wichteln Wicke Widder Wider den Stachel lecken Wie David und Goliath Wie besessen sein Wiedehopf Wiedergeburt Wie der verlorene Sohn sein Wie die Mutter, so die Tochter Wie ein Dieb in der Nacht Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird Wie ein Mann Wie ein offenes Buch Wie ein schwankendes Rohr sein Wie ein Ölgötze Wie im Paradies – Im Paradies sein Wie in Abrahams Schoß (sitzen) Wie in einem Elfenbeinturm leben Wiesenknopf Wiesenschaumkraut Wie vom Erdboden verschluckt Wind Winterpuppe Wolf Wolf, Dr. Notker (Werner) Wormser Edikt Wortgottesdienst Wunder Wurm Wurzel Jesse Wüste
- X
- Y
-
Z
Zaanan Zacharias Zachäus Zadok Zafon Zalmona Zander, Hans Conrad Zannanannim Zaretan Zaïr Zebaoth Zebedäus Zeboïm Zedad Zeder Zefanja Zefat Zehn Zela Zelebrant Zelebration versus populum Zelofhad Zeloten Zelzach Zemarajim Zenan Zer Zereda Zeremoniar Zeremonie Zeugen Jehovas Ziborium Ziddim Ziege Ziklag Zimt Zingulum Zink, Jörg Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von Zion (Berg) Zion, Tochter Zior Zippora Zistrose Zitronat-Zitrone Zitrone Zitronengras Zitronenmelisse Zitwer Zoar Zofar Zora Zu allem ja und amen sagen Zu etwas kommen wie die Jungfrau zum Kind Zukic, Schwester Teresa Zum Eckstein werden Zum Himmel schreien Zum Tempel hinausfliegen Zungenrede Zur Hölle fahren Zur Salzsäule erstarren Zwei Zweihundert Zweiundsiebzig Zwerg-Zichorie Zwiebel Zwingli, Ulrich (Huldrych) Zwischen Himmel und Erde schweben Zwischengesang Zwölf Zwölf Nächte Zwölf Schaubrote Zwölfbotentag Zyperblume Zypern Zypresse Zyrene Zölibat Zöllner, Dina Zöllner, Zöllnerinnen
- #
- Impulse durch das Kirchenjahr
- Kinderseite
-
Wissensbibliothek
-
Christliches Lexikon
- Ämter
- Anlässe & Begebenheiten
- Begriffe
- Ein Gang durch das Gotteshaus
- Gottesdienste
- Heilpflanzen
- Orte
- Persönlichkeiten
- Redewendungen
- Symbole
- Zahlensymbolik
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Die Bibel
- Bücher der Bibel
- Frauen der Bibel
- Karten der Bibel
- Männer der Bibel
-
Menschen der Bibel
- Pflanzen der Bibel
- Stammbäume der Bibel
- Stätten der Bibel
- Tiere der Bibel
- Feiertage & Brauchtum
- Heilige & Namenstage
-
Christliches Lexikon
- Jahreslosungen
- Gelebter Glaube
- Blog
Petrus
Petrus (aram. kephas = Fels) ist der Name eines Apostels, der wegen seines Bekenntnisses zum Patron der Kirche und des Papsttumes geworden (Mt 16,15-19) ist.
Kaum eine Gestalt des Neuen Testamentes ist von einer solchen Dramatik bewegt wie die des Petrus: von der Fischerbarke hinweg zur Nachfolge Christi berufen, gewinnt er eine fundamentale Bedeutung für den Ausbau des Gottesreiches und wächst in der Kraft göttlicher Vorherbestimmung zum großen Menschenfischer empor, der in kühnem Wurf sein Netz über das ganze Mittelmeer auswirft.
Auch ragt keine zweite Gestalt des Neuen Bundes so lebendig unvergänglich in die Gegenwart hinein wie Petrus. Als erstes Glied einer glorreichen Kette lebt er in seinen Amtsnachfolgern weiter und spricht zum christlichen Erdkreis bis auf den heutigen Tag. Petrus steht uns auch menschlich nahe wie kein zweiter Apostel.
Er war ganz Mensch wie wir, mit dem gleichen Drang zum Guten, mit dem gleichen Hang zum Bösen, wie wir, kämpfend und ringend, aufrecht stehend und strauchelnd, eine Mischung von Hell und Dunkel, Licht und Schatten.
Petrus heißt eigentlich Simon
Eigentlich hieß er Simon. Jona (Mt. 16,17) oder Johannes (Jo 1,42; 21,15), sein Vater, hatte ihn als Kind schon auf die Knie genommen und ihm das "Höre Israel", die zehn Gebote und die andern Kernstücke der Thora beigebracht. Sein Bruder hieß Andreas. Beide stammen aus Bethsaida (Jo 1,44), das im Evangelium oft genant wird und dessen Name schon auf das blühende Fischereigewerbe hinweist, denn Bethsaida heißt eigentlich "Fischfanghausen".
Es lag nach der weitaus wahrscheinlichsten Annahme am Ostufer des Jordans, nahe bei dessen Einmündung in den See Genesareth, wo heute das Trümmerfeld von chirbet el-aradsch liegt, und besaß einen der reichsten Fischgründe am See. Die vom Jordan her angeschwemmten pflanzlichen und tierischen Stoffe wirken wie ein Magnet auf die Fische, die sich hier in gewaltigen Schwärmen tummeln und im Schlamm reichlich Nahrung finden.
In diesem Fischerdorf, das selbst zwar jüdisch war, sich aber unmittelbar in heidnischer Umgebung befand, war Simon, der Sohn des Jona, von Sonne und Luft tiefdunkel gebräunt, aufgewachsen. Hier stand einst irgendwo, von ein paar blühenden Oleanderbüschen umrahmt, sein Elternhaus, und hier muss er, wie noch heute die Fischer am See, zum Fischfang mit Wurf- Schlepp- und Hängenetz ausgefahren sein.
In Bethsaida, der Heimatstadt des Simon, hat später Jesus viele Wunder getan, von denen uns im Evangelium allerdings nur eines überliefert wurde: die Heilung des Blinden. Wie anschaulich kann Markus, hinter dem ja Petrus steht, erzählen!
Als Jesus nach Bethsaida gekommen war, wurde ihm ein Blinder zugeführt. Um kein Aufsehen zu erregen, "nahm er den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus ... Hier legte er ihm die Hände auf und fragte ihn: "Siehst du etwas?" Jener sah sich um und erwiderte: "Ich sehe die Menschen, ich sehe sie wie wandelnde Bäume." Danach legte Jesus die Hände nochmals auf die Augen. Und als der Blinde scharf hinsah, war er wiederhergestellt und sah jetzt alles ganz genau. Da schickte ihn Jesus heim mit den Worten: "Geh aber nicht in das Dorf hinein." (Mk 8,23-26).
Trotz der vielen Wundertaten Jesu und trotz der gewaltigen Predigten, die er hier vor ihren Einwohnern hielt, blieb die Stadt ungläubig. Darum hat Jesus sie samt den beiden benachbarten Ortschaften Chorazin und Kapharnaum verflucht: "Weh dir, Bethsaida! Denn wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan". (Mt 11,21).
Furchtbar hat sich dieser Wehruf Jesu an Bethsaida erfüllt. Von der Stadt ist kein einziger Stein mehr zu sehen. Wie die unter einer starken Schwemmsandschicht liegende, intensiv schwarzgefärbte Scherbendecke aus der Zeit Jesu bezeugt, muss Bethsaida einer totalen Zerstörung zum Opfer gefallen sein, bevor es durch die Anschwemmungen des Jordans zugedeckt wurde.
"Der Herr ist wirklich auferstanden und dem Simon erschienen!"
Es war am Ostersonntagmorgen, als Petrus und Johannes, vom Grab des Herrn kommend, dem Abendmahlshaus in der Oberstadt zustrebten. In den engen, teilweise überdachten Straßen war es bereits wieder lebendig geworden. Überall herrschte reges Leben und geschäftiges Treiben.
Aus den dunklen Höhlen der Werkstätten klang das Hämmern und Feilen der Handwerker. Wasserverkäufer eilten, die prallgefüllten Ziegenlederschläuche auf dem Rücken tragend, straßauf, straßab. Feilschende Händler priesen lärmend und schreiend ihre Waren an. Lastträger gingen tiefgebeugt unter schweren Säcken und Kisten einher. Hin und wieder schritt, von einem Leitesel geführt, eine schwerbeladene Kamelkarawane schaukelnden Schrittes vorbei, ein Tier an das andere gekoppelt.
Petrus und Johannes suchten sich inmitten dieses dichten Menschenstroms mühsam einen Weg zu bahnen. Es war nicht leicht, sich durch das schillernde Chaos der vollgestopften Gassen zum Abendmahlshaus durchzuschlagen. Bald blieben die beiden im Gedränge stecken, bald wurden sie unsanft auf die Seite geschoben.Als sie endlich das Abendmahlshaus erreichten und das Obergemach, in dem die Apostel versammelt waren, betraten, war Petrus ganz außer Atem.
"Maria Magdalena hat uns berichtet", so begann er, aufs höchste erregt, in abgehackten, hastigen Sätzen zu sprechen, "sie haben den Herrn fortgetragen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Darauf eilten wir beide, Johannes und ich, zum Grab. Johannes lief voraus und kam zuerst zum Grabe. Er beugte sich vor und sah die Leinenstreifen liegen, ging aber nicht hinein. Indessen war auch ich zur Gruft gekommen. Ich trat ein und erblickte auf der Grabbank die Leinenstreifen, in die der Leichnam eingewickelt worden war, und etwas abseits, sorgfältig zusammengefaltet an einem besonderen Platz, das Schweißtuch, mit dem sein Haupt verhüllt war" (Jo 20,1-10).
Hier machte Simon eine Pause, um tief Atem zu schöpfen, und begann dann neuerdings zu sprechen. Sein Antlitz leuchtete, und Tränen der Freude glänzten in seinen Augen, als er nun weiter erzählte, wie ihm danach der Herr erschienen war und er Zeuge der Auferstehung Christi werden durfte.
Am späten Abend weilten die Apostel wieder im Obergemach, im gleichen Raum, in dem der Herr das Abendmahl mit ihnen gefeiert hatte. Wie damals umfing auch jetzt die Stille einer Mondnacht das Haus, und der Sternhimmel schimmerte durch das Fenster des Raumes, in dem zahlreiche Öllampen brannten.
Wie damals lagen auch jetzt die Apostel auf ihren Ruhebetten um den hufeisenförmigen Tisch. Plötzlich aber richteten sie sich auf: durch den Hofraum hallten wuchtige Schläge. Zwei Männer begehrten Einlass am Vordertor, das von der Straße aus Zugang zum offenen Hofe gab, und pochten mit dem eisernen Türklopfer unablässig gegen das Holztor. Auf die Frage: "Wer ist dort?" kam es von draußen zurück: "Kleophas und sein Gefährte!"
Als sie nun vorsichtig öffneten, erkannten die Apostel in der Dunkelheit der Nacht die beiden Jünger, die in der ersten Morgenstunde von Jerusalem nach einem Dorf namens Emmaus aufgebrochen waren und dort den Herrn gesehen hatten. Bevor sie aber noch den Mund öffnen und von ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen, den sie am Brotbrechen erkannt hatten, berichten konnten, jubelten die Apostel ihnen die Osterbotschaft entgegen: "Der Herr ist wirklich auferstanden und dem Simon erschienen" (Lk 24,34).
Wohl erwähnen die Evangelien kurz die Tatsache dieser ersten Christuserscheinung vor Petrus allein, leider aber fehlt ein ausführlicher Bericht. Auch Paulus spricht im ersten Korintherbrief, in einem der ältesten christlichen Texte, die wir überhaupt besitzen, von diesem wichtigen Ereignis. Er schreibt: "Er ist dem Kephas erschienen, dann den Zwölfen, darauf über fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen ja die meisten noch am Leben sind." (1.Kor 15,5-6).
Paulus betonte, dass Kephas der erste war, dem der Herr erschien. Mit dieser Ersterscheinung, die doppelt bedeutsam war im Blick auf die vorangegangene Verleugnung, drückte der auferstandene Christus sozusagen das Siegel auf die besondere Auszeichnung, die er zu seinen Lebzeiten dem Kephas hatte zuteilwerden lassen. Sie trug in der ersten Zeit in hohem Maße zu seiner Autoritätsstellung als oberster Leiter der jungen Kirche bei, und allein schon um diese Bevorzugung willen wurde Petrus als Sonderbeauftragter Christi angesehen.
Eines Tages machte Petrus eine Rundreise bei allen
Petrus, der unbestritten als Oberhaupt der ganzen Kirche galt, war sich bewusst, dass der Herr ihm während seines Erdenwandels gesagt hatte: "Wenn du einst bekehrt sein wirst, stärke dein Brüder" (Lk 22,32).
Da inzwischen die Verfolgung der Christen in Palästina nachgelassen hatte und die Kirche sich allerwärts des Friedens erfreute, wollte er diese Zeit der Ruhe zu einer apostolischen Visitationsreise bei den christlichen Gemeinden benützen. "Eines Tages machte Petrus eine Rundreise bei allen " (Apg 9,32).
Auf seiner Visitationsreise kam Petrus auch zu den "Heiligen, die in Lydda wohnten" (Apg 9,32), wo er "einen Mann mit Namen Aeneas, der seit acht Jahren gelähmt zu Bette lag" (Apg. 9,33), heilte. Darauf zog er nach Joppe, dem heutigen Jaffa, wo er Tabitha, eine Jüngerin des Herrn, die als Armenmutter "voll guter Werke und Almosen" (Apg. 9,36) das stille Diakonat der Caritas ausübte, von den Toten auferweckte.
"Petrus aber blieb noch geraume Zeit in Joppe bei einem gewissen Simon, der Gerber war" (Apg. 9,43). Wer mag dieser stille, alte Mann im Hafenquartier von Joppe, der den Oberhirten der Kirche in sein Haus aufnahm, gewesen sein? Nach dem Namen zu schließen, sicher ein Jude, und da Petrus "geraume Zeit" bei ihm verweilte, wahrscheinlich ein zum Christentum bekehrter Jude.Ja, vielleicht diente sein "Haus am Meere" (Apg. 10,6) als Versammlungsplatz und gottesdienstlicher Raum.
Wie viele Besuche mag der Apostel während seines Aufenthaltes hier empfangen haben! Denn auf die Kunde von der Erweckung der Tabitha strömten die Menschen von überall herbei, nicht nur die Stadtbewohner, sondern auch einfache Leute aus der nahen Saron-Ebene. Zu zweien und dreien kamen sie nächtlicherweile, saßen beim trüben Licht eines Öllämpchens auf der Terrasse des Hauses und erhielten durch Petrus Kunde von Jesus von Nazareth.
Ein Problem, das Petrus in dieser Zeit stark beschäftigte, war die Frage der Heidenmission. Seit er unter der buntgemischten Bevölkerung dieser Hafenstadt mit ihrem fröhlichen Gewimmel von Matrosen, Lastträgern, Sklaven, Fischern und Verkäufern lebte, war ihm mit jedem Tag klarer geworden: "Gott sieht nicht auf die Person" (Apg. 10,34).
Nicht nur die Juden sind in sein Reich berufen sondern auch die Heiden. Er spannt seine Zelte aus über alle Völker. Solchen Gedanken nachhangend, stieg Petrus eines Tages um die Mittagsstunde die Stufen zu dem flachen Dach des Gerberhauses hinauf, um zu beten. Sein Blick schweifte dabei hinaus auf die Wasser des großen Meeres, das in ruhigen Atembewegungen schaumgekrönte Wellen ans sandige Ufer warf.
Weit draußen sah er die Masten und die bunten Segel der Schiffe aus Cäsarea, Akko, aus Tyrus, Sidon und Zypern, die im Hafen von Joppe vor Anker lagen und Waren aus aller Herren Länder löschten. Simon, Bar-Jona, war ein Binnenländer, der an den Ufern des Sees Genesareth aufgewachsen war. Bisher hatte er nur in stillen Binnengewässern gefischt. Und nun erwachte beim Anblick des großen Meeres in ihm plötzlich die Sehnsucht nach anderen Gestade.
"Wie groß ist deine Welt, o Herr, und wie weit spannt sich dein Himmel", dachte Petrus. "Diese tief blauen Wasser führen zu den fernsten Ländern. Sie bespülten die Küste von Alexandrien, Ephesus, Korinth, von Puteoli, Ostia und Rom. Sie reichen bis zu den Völkern der Inseln. Und in allen diesen Städten, Provinzen und Inseln leben Menschen, die den Namen des wahren Gottes noch nicht gehört haben und vom Erlöser nichts wissen. Und doch sehnen sie sich nach seiner Botschaft."
Simon hatte es in den Gesichtern der Besucher, die zu ihm ins Gerberhäuschen gekommen waren, deutlich gelesen. Wie dürsteten sie nach der Erlösung! Und wie gierig lauschten sie der Frohbotschaft! Gewiss hatte man sie vom Eintritt ins Reich Gottes nicht ausgeschlossen, aber sie gelangten zu Jesus nur durch Moses, zur Taufe nur durch die Beschneidung, zur Gnade nur durch das Gesetz.
Warum mussten sie sich dem Gesetz unterwerfen? Wünschte Gott nicht das Heil der ganzen Menschheit? Hatte der Herr, als er ihnen nach der Auferstehung erschienen war, nicht selbst gesagt: "Ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria, ja bis an die Grenzen der Erde" (Apg. 1,8).
Simon, Bar-Jona, der den Herrn täglich gesehen hatte, erinnerte sich noch gut, wie liebevoll er dem heidnischen Hauptmann von Kapharnaum begegnet war, wie er seinen Knecht gesund gemacht hatte.
Damals hatte er gesagt: "Viele werden von Osten und Westen kommen und im Himmelreich mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische sitzen" (Mt. 8,11). Gott hatte ihn, Simon Petrus, wohl nicht ohne Grund zum Menschenfischer berufen? Sein einfacher Fischersinn sagte ihm doch, dass man das Netz dort auswerfen muss, wo der Fang am ertragreichsten ist. Er hatte sein Gewerbe in kleinen Binnengewässern begonnen. Aber wartete jetzt nicht das große, weite Meer auf ihn?
In solche Gedanken vertieft, verspürte Petrus plötzlich ein starkes Hungergefühl und wollte etwas essen. Während man ihm die Mahlzeit zubereitete, kam eine Verzückung über ihn: "Er schaute den Himmel offen und sah etwas wie ein großes, leinenes Tuch herabkommen, das an seinen vier Enden zur Erde herabgelassen wurde. Darin waren allerlei Tiere, vierfüßige und kriechende und auch Vögel.
Und eine Stimme rief ihm zu: "Auf Petrus, schlachte und iss!" Petrus aber sprach: "Nie und nimmer, Herr! Noch nie habe ich etwas Gemeines und Unreines gegessen." Da sprach die Stimme zum zweiten Mal zu ihm: "Was Gott gereinigt hat, darfst du nicht unrein nennen." Das geschah dreimal. Dann wurde das Tuch in den Himmel hinaufgezogen" (Apg. 10,11-16).
Während Petrus noch im unklaren war und darüber nachdachte, was dieses Gesicht wohl zu bedeuten hätte, erschien der Graukopf des Gerbers Simon von der Treppe her und sagte zu ihm: "Es stehen drei Männer vor der Türe, die nach dir gefragt haben und dich sprechen wollen. Sie kommen aus Cäsarea." Von ihnen erfuhr Petrus nun folgendes: "Der Hauptmann Cornelius, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der beim ganzen jüdischen Volk in gutem Rufe steht, ist von einem heiligen Engel angewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen, um von dir zu hören, was du ihm zu sagen hast." (Apg 10,22).
Jetzt kam über Simon plötzlich die Klarheit des Geistes, um die er gebetet hatte, und er begriff auf einmal, "dass man keinen Menschen gemein oder unrein nennen darf" (Apg 10,28), dass die Religion Jesu Christi vielmehr auch der Sauerteig für die Heidenwelt werden müsse.
Er begab sich nun mit den Boten und sechs Brüdern - die Christen nannten sich damals Brüder - auf den 50 Kilometer dem Meer entlang führenden Weg von Joppe nach Cäsarea. Cornelius, ein ehrlicher Wahrheitssucher, der hier residierte und vielleicht zum weitverbreiteten Geschlecht der Cornelier gehörte, erwartete Petrus und seine Gefährten und hatte seine Verwandten und engsten Freunde um sich versammelt.
Wie einem höheren Wesen fiel er an der Türe dem Apostel zu Füßen, "Petrus aber hob ihn auf und sprach: Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch" (Apg 10,26). "Dann trat er ein, mit ihm redend" (Apg. 10,27), der galiläische Fischer mit dem römischen Offizier, der Träger der Himmelsschlüssel im Gespräch mit dem Träger des Schwertes.
Cornelius hielt eine Begrüßungsansprache, die mit den Worten schloss: "Jetzt sind wir alle vor dir versammelt, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen wurde" (Apg. 10,33). Da trat Petrus seinen Mund auf und sprach: "In Wahrheit erkenne ich jetzt: Gott sieht nicht auf die Person, vielmehr ist ihm jeder wohlgefällig, wer immer ihn fürchtet und Gerechtigkeit über, zu welchem Volk er auch gehören mag."
Da brach der Pfingsttag der Heidenwelt an, und das Soldatenquartier verwandelte sich in eine Taufkapelle: der Heilige Geist kam auf die Zuhörer der apostolischen Predigt, und alle, Cornelius voran, ließen sich taufen. Petrus aber, der damit zum ersten Missionar bei den Heiden geworden war und als Bauherr den Grundstein zur Weltkirche gelegt hatte, blieb noch einige Tage im Hause des Cornelius, um zu befestigen, was die Taufe bewirkt hatte.
Petrus kommt nach Rom
Mit den Worten "Und er begab sich an einen anderen Ort" (Apg. 12,18) beschließt Lukas die "Petrushälfte" oder die "Petrusakten", wie die ersten zwölf Kapitel der Apostelgeschichte auch genannt werden, um seine Aufmerksamkeit in den Kapiteln 13-28, der sogenannten "Paulushälfte" oder den "Paulusakten", ganz der Persönlichkeit des Heidenapostels zuzuwenden.
Es ist wohl anzunehmen, dass Petrus, um der Reichweite des Herodes zu entfliehen, sich außerhalb Palästinas begab. Nach einer alten Tradition, die uns durch Eusebius, den "Vater der Kirchengeschichte" und Hieronymus, den "Vater der Bibelwissenschaft" bezeugt wird, begab sich der Apostelfürst nach seiner Fluch nach Rom, wo er die Leitung der Kirche übernahm.
Sein Aufenthalt in dieser Stadt, der nach der Reformation lange Zeit eine Streitfrage zwischen Protestanten und Katholiken darstellte, ist heute durch archäologische und liturgische Denkmäler wie auch durch literarische Zeugnisse so sicher erwiesen, dass er nicht mehr angezweifelt werden kann.
Selbst protestantische Forscher wie Harnack, Lietzmann und Cullmann lassen den Aufenthalts Petri in Rom als erwiesene Tatsache gelten. Unsicher und umstritten ist einzig der Zeitpunkt seiner Ankunft in der Ewigen Stadt.
Mit guten Gründen darf aber angenommen werden, dass Petrus schon frühzeitig, wahrscheinlich im Jahre 42, nach Rom gekommen ist. Harnack sagt dazu: "Herodes ist im Jahre 44 gestorben, nachdem er erst unter Claudius im Jahre 41 Judäa und Samaria erhalten hatte. Also fällt die Übersiedlung des Petrus "nach einem andern Ort" zwischen 41 und 44, das heißt, gegen das Datum 42 ist von hier aus nichts einzuwenden. Die alte Überlieferung fußt auf gutem Grund, und nichts hindert sie für historisch zu halten."
Es war wohl im April des Jahres 42, als Simon, Bar-Jona, begleitet von einigen Getreuen, von Jerusalem zum Hafen von Joppe kam. Es lässt sich leicht denken, dass der römische Hauptmann Cornelius, der Träger des Schwertes, den Petrus als Erstling aus der Heidenwelt in die Kirche aufgenommen hatte, sich eine Ehre daraus machte, dem Träger der Himmelsschlüssel bei der Überfahrt von Joppe nach Italien persönlich oder durch Freunde behilflich zu sein.
Die enge Verbindung des Petrus mit dem römischen Hauptmann Cornelius würde auch erklären, warum sich die Familie der Cornelier, die Gens Cornelia in Rom, deren Haus auch Priscilla als Verwandte oder Freigelassene angehörte, schon sehr früh dem Christentum angeschlossen hat. In Joppe bestieg Petrus einen Segler, der nach Italien fuhr und eine Anzahl Kaufleute an Bord hatte. Kaum hatte Simon seinen Fuß auf das Schiff gesetzt, schloss er auch schon mit den reisenden Matrosen und Kaufleuten Bekanntschaft.
Als alter, erfahrener Seebär, der mit Segeln und Tauen wohl umzugehen wusste, verstand er es, sich mit der Schiffsmannschaft bald anzufreunden. In seiner leutseligen Art unterhielt er sich wohl gleich mit dem Obersteuermann, den Ankerleuten, den Männern, die die Segel bedienten, und sprach zu ihnen von der Erlösung durch Jesus Christus. Das Schiff lief zuerst die Inseln von Zypern, Kreta und Malta an und segelte dann über Syrakus auf Sizilien, am Rhegium vorbei, durch die Meerenge von Messina nach Puteoli bei Neapel.
Nach der Landung in diesem ersten Hafen Italiens zog Petrus mit seinen Gefährten landeinwärts auf der Straße nach Rom. Zwischen den beiden Bergen hinter Puteoli führte die Straße in herrliches Land hinein, das im Glanze des Frühlings vor den Augen der Wanderer lag. Von Capua kamen sie auf der heute noch berühmten Via Appia, der Königin aller Straßen, weiter nach Rom.
Zweifellos ging es auf dieser Hauptverkehrsader des Reiches sehr lebhaft zu. Die tiefeingegrabenen Radspuren in der mit mächtigen Basaltsteinen gepflasterten Straße reden eine deutliche Sprache. Elegante Reisekutschen und schwerfällige Wagen, Kaufleute, Freigelassene und Sklaven, vor allem aber Tausende von Legionären zogen auf diesem Weg dahin.
Als er endlich die Höhe der Albanerberge erreichte, erblickte Petrus zum ersten Mal die weite Ebene der römischen Campagna und, wie ein großes, graues Schiff, tief in der Landschaft verankert, die Siebenhügelstadt, das ewige Rom.
Der Apostel stieg hinunter in die Weite der im südlichen Licht schimmernden Landschaft und betrat den ruhmreichsten Teil der Via Appia, jenen von der frühen Geschichte Roms umwitterten und von einem unbeschreiblichen zauber umwobenen Weg, bestanden von dunklen Zypressen und Pinien, der wie kaum eine andere Stätte die Schönheit der Welt und die Mahnung an deren Vergänglichkeit erschütternd zum Ausdruck bringt und gleichzeitig zum Symbol Roms und seiner Kraft geworden ist.
Mit jedem Schritt wurde der Atem der Größe Roms spürbarer. Waren die unabsehbaren, schwungvollen Bogenreihen der Aquädukte der Aqua Claudia, über denen Winde dahinzogen und unter denen die Herden weideten, nicht wie der Flügelschlag der siegreichen Adler Roms?
Von den großartigen Grabdenkmälern, die rechts und links die Straße säumten, blickten die Häupter der stolzesten römischen Adelsgeschlechter auf Simon, Bar-Jona, herab, die Scipionen, die Meteller, die Valerier und viele andere. Aber keines der ernsten Gesichter, die, geborgen unter dem Giebel eines Daches, ihn prüfend musterten, ahnte, dass der ärmlich gekleidete Wanderer mit dem abgetragenen Mantel der Fürst der Apostel war, der, mehr als sie alle, Rom zu Ruhm und Größe bringen sollte.
Da wo sich jetzt über dem Grab des Apostelfürsten in jubelnder Vollendung die herrliche Kuppel Michelangelos wölbt, erblickte Petrus damals die von Gartenanlagen umgebene Rennbahn des Caligula und jene große Wasseranlage der Naumachia, in der ganze Seeschlachten dargestellt werden konnten.
Rom aber, abgesehen von der Pracht des Forums und des Palatins, eine häßliche, schmutzige, übelriechende Stadt mit vielstöckigen Häusern. Nero, der von 54-68 Kaiser war, klagte über Roms stinkende Gassen, das schlechte Pflaster, die krummen und engen Durchfahrten, das lärmige Geschiebe und Getriebe in den Hauptgeschäftszeiten, die schlechte Beleuchtung der Straßen und das Quietschen der Wagenkolonnen in den ersten Morgenstunden.
Die Servianische Stadtmauer umschloss ein Gebiet von kaum 426 Hektar. Eine Million Menschen kämpfte um jeden Fußbreit Erde. Die Bodenspekulanten trieben die Preise der Häuser in die Höhe. Eng und schmal schossen sie in den Himmel von Latium, nicht viel mehr als Holzgerüste, oft ein Raub für Flammen. Die von Cäsar Augustus eingesetzte Feuerwehr von siebentausend Mann kam meistens zu spät.
Im Jahre 27 brannte das Caeliusviertel ab, zehn Jahre später folgte die Vernichtung sämtlicher Gebäude des Aventin. Rom konnte sich nicht ausbreiten, deshalb baute man übereinander und durcheinander. "Ein Meer von Lärm, in dem man weder denken noch dichten kann", stöhnte schon Horaz im Jahre 8 v. Chr. Juvenal, um die Mitte des ersten Jahrhunderts geboren, klagte über das Geschrei der Maultiertreiber: "In welchem Raum ist es noch möglich zu schlafen!".
Der Krach sei so groß, als ob er im eigenen Zimmer vollführt würde, schrieb sein Zeitgenosse Martial. Die lautesten Berufe hatten ihre Werkstätten mitten in der Stadt.
In dieser Enge fand Kaiser Nero für seine gigantischen Baupläne keinen Platz. Das alte römische Regierungsviertel, der Palatin, mit dem fast bürgerlich anmutenden Haus des Augustus und dem prächtigeren Palast des Tiberius genügte ihm nicht mehr. Unwillig strich Nero nachts durch die Straßen.
Durch einen alten Bauernhut unkenntlich gemacht, verband er sich halbwüchsigen Gesellen. Mit Brecheisen öffneten sie die Tore zu schönen Frauen. Pförtner wurden verprügelt, Passanten gefesselt und alle, die sich wehrten, in die Kloaken geworfen. In den Gassen blühte das Laster, und es war ein Abenteuer, nachts ohne Begleitung nach Hause zu finden. Die Polizei war mit Äxten und Eimern ausgestattet, um Funken zu ersticken, und hatte verdächtige Subjekte festzunehmen.
Dazu ein Heerlager von Armen, die im Freien nächtigten. Im orientalischen Stadtviertel tummelten sich am Tage die Kinder und verschwanden des Nachts hinter den mächtigen Mauern der Porta Capena. Haufen fremdländischen Volkes hausten in den Arbeitervierteln jenseits des Tibers in Trastevere, dem "Loch Roms, wo die freigelassenen Kriegssklaven wohnten und auch die meisten Juden Unterkunft hatten.
Das eigentliche Proletariat lebte in der Subura an den Hängen des Esquilin. Dort kauften die kleinen Leute ein. Raufereien und wüstes Geschrei war an der Tagesordnung, und nachts lockten aus niedrigen Fenstern die Frauen ihre Käufer an.
Simon, Bar-Jona, der einfache Fischer aus Galiläa, fühlte sich wohl anfangs in der Hauptstadt des Imperiums mit ihren Palästen und Tempeln, ihren schmutzigen, übelriechenden Gassen und Straßen, ihren vielstöckigen Wohnhäusern und überfüllten Mietskasernen, ihren Sklaven und Legionären, ihren Adeligen und Herrschern nicht zuhause.
Nur mit innerem Missbehagen beobachtete er den erschütternden Kontrast zwischen dem menschlichen Sumpf im Elendsquartier der Subura und dem ausschweifenden Luxus der eleganten Via Sacra, beide so dicht beieinander. Die gewaltige und zugleich gewalttätige Stadt der Cäsaren mit ihrem Kaiserkult, ihrer Unterdrückung der menschlichen Freiheit und Würde, ihrer Grausamkeit und Ausschweifung - eine Cloaca Maxima - kam dem einfachen Fischer aus Bethsaida vor wie eine betrunkene Dirne, ein Babylon voll Zauberei, Buhlerei, Mord und Götzendienst.
Nach der Tradition predigte Petrus zuerst seinen jüdischen Landsleuten in der Synagoge von Trastevere am rechten Tiberufer, dann auf dem Aventin im gastlichen Hause von Aquila und Priscilla und im Gebiet zwischen der Via Salaria und Nomentana. Dort, im Vicus Patricius, nicht weit von der Subura, zwischen Esquilin und Viminal.
Wo sich heute die Santa Pudenziana, eine der ältesten und schönsten Kirchen Roms, erhebt, stand nach der Überlieferung das Haus des vornehmen römischen Senators Pudens, in dem Petrus als Gast wohnte. Ausgrabungen, die unter dieser Kirche gemacht wurden, haben diese Annahme bestätigt. In einer Tiefe von neuen Metern unter dem Fußboden der Kirche wurden tatsächlich Reste eines großen Hauses aus der Zeit Neros freigelegt.
Seine geräumigen Kammern mit Bädern, einer eigenen Mühlanlage, guterhaltenen Mosaikfußböden und Fresken lassen die Wohlhabenheit des Besitzers erkennen. Aufgefundene Ziegelsteine tragen als Stempel den Namen des Pudens und lassen vermuten, dass der Hausbesitzer Ziegelfabrikant war. Von Petrus zum Glauben geführt und getauft, stellte er sein Haus den ersten Christen als Versammlungsort zur Verfügung.
"Euer Glaube ist gerühmt in der ganzen Welt"
Sieben Jahre predigte Petrus mit großem Erfolg das Evangeliums zu Füßen des weltbeherrschenden Kapitols. Der einfache Fischer mit seiner anschaulichen, bildhaften Sprache, seiner freundlichen Schlichtheit und warmherzigen, gewinnenden Art zog viele an. Unzählige Juden und Heiden kamen zu den Gottesdiensten, um seine Predigten zu hören.
Die römische Christengemeinde, die aus der jüdischen Diasporagemeinde hervorgegangen war und die Petrus entscheidend beeinflusst hatte, wurde zum leuchtenden Beispiel für die christlichen Gemeinden in der ganzen Welt. Wir sind bei der Rekonstruktion ihrer Wesensart auf die wenigen Striche angewiesen, mit denen sie Paulus im Römerbrief skizziert. Es sind nur Fragmente, Einzelzüge, aber bedeutsam genug, um uns das geistige Bild dieser Gemeinde einzuprägen.
Paulus schrieb seinen Römerbrief an eine blühende Gemeinde, die viele Gläubige zählte. Nach Tacitus war sie im Jahr 64 bereits eine "multitudo inens- eine ungeheure Menge". Die jüdische Bevölkerung betrug etwa 30.000, die christliche vielleicht die Hälfte davon, doch wuchs sie täglich.
Die Petrusgemeinde in Rom umfasst in den verschiedenen Stadtteilen bereits mehrere häusliche Gemeinschaften. Paulus zählt in der Grußliste des Römerbriefes, in der natürlich nur ein kleiner Teil der römischen Christen genannt wird, drei solche häusliche Gemeinschaften auf, die sich an einem bestimmten Ort zu gottesdienstlichen Versammlungen zusammenfanden.
Da war einmal die Hausgemeinde der Priscilla und des Aquila, in deren Haus die Christen sich zum Gottesdienst versammelten; eine andere bestand aus "Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und einigen anderen Brüdern" (Röm. 16,14). Wieder andere gruppierten sich um Philologus und Julia, um Nereus und seine Schwester, Olympas und alle "Heiligen", die bei ihnen sind. Wir dürfen wohl in der festgefügten Organisation dieser häuslichen Gemeinschaften bereits die Anfänge der urchristlichen Pfarreibildung sehen.
Die römische Christengemeinde des Apostels Petrus muss völkisch eine kunterbunt zusammengewürfelte Menge gewesen sein. In der Grußliste des Römerbriefes (16,1-16,9 begegnen uns griechische, hellenistische und jüdische Namen in bunter Reihenfolge. Einige sind bestimmt jüdischer Abstammung, so Andronikus, Junias, Herodion, die Paulus ausdrücklich als Stammesverwandte bezeichnet. Auch die dort erwähnte Maria muss eine geborene Jüdin aus Palästina gewesen sein.
Wir erhalten in der Grußliste des Römerbriefes aber auch Einblick in die soziale Zusammensetzung der Petrusgemeinde. In Aristobul und Narzisus werden zwei vornehme, reiche Herren aus den oberen Ständen genannt, die offenbar am kaiserlichen Hof sehr angesehen waren. Daneben finden sich einige typische Sklavennamen wie Ampliatus, Stachys, Apelles, Persis, Hermes und Julia.
Vielleicht dürfen wir daraus den Schluss ziehen, dass das Christentum in Rom vor allem in die unteren Volksschichten der "Mühseligen und Beladenen" gedrungen war. Diese Annahme wird auch durch die Ausgrabungen in den römischen Katakomben bestätigt. Wir finden da auf den christlichen Grabinschriften einen Bäcker, einen Schmied, eine Schneiderin, Maler, Marmorarbeiter, Elfenbeinschnitzer, einen Drogisten, einen Konditor, einen Friseur und einen Rossknecht, Gärtner, Obsthändler, Angestellte und kleine Beamte, Notare, Lehrer und nicht wenige Soldaten in der verschiedensten Stellungen.
Auch von der Religion her gesehen, muss die römische Christengemeind ein buntes Gemisch gewesen sein. Einge hatten früher griechische Götter angebetet, andre kamen vom Mithrasdienst, phrygischen Kybelekult oder ägyptischen Isis-Osiris-Dienst her. Es war sicher für Petrus keine leichte Aufgabe, aus diesen völkisch, sozial und religiös gemischten Menschen eine Gemeinde zu gründen.
Und doch wurden sie in Christus zu einer wirklichen Einheit, zu einer einzigen Familie in Gott. Nach dem Inhalt des erwähnten Briefes (16,17-19) zu schließen, lebten Juden-und Heidenchristen ohne Parteiungen, Spaltungen und feindliche Gegensätze in Eintracht miteinander, wenn auch anscheinend noch manche ängstlichen Gemüter der Meinung waren, sie müssten das jüdische Zeremonialgesetz beobachten (14).
Die Gemeinde war eine von Liebe und Eintracht geheimnisvoll erfüllte Gemeinschaft. Die Gläubigen waren "in Bruderliebe herzlich miteinander verbunden " (Röm. 12,10), "um die Bedürfnisse der Heiligen besorgt" (Röm. 12,13), "voller Gutheit und angefüllt mit aller Gnosis, damit aber instand gesetzt, sich selbst durch Ermahnung gegenseitig zu helfen" (Röm 15,14).
Ein zweiter Zug, den Petrus der römischen Urgemeinde aufgeprägt hatte, war ihr Glaube. Der eine lebendige Glaube an den Herrn Jesus Christus schmiedete alle machtvoll zusammen. Er war der gemeinsame tragfähige Boden, das gemeinsame schützende Dach und die ganze Gemeinde ein fester Kreis Gleichglaubender.
Paulus, der die Mehrzahl der damaligen heidenchristlichen Einzelkirchen den Glauben gebracht hatte und diesen auch fest und bestimmt überwachte und vor jedem Abgleiten bewahrte, setzt auch für die römische Kirche, die er anspricht, dieselbe Glaubenszucht voraus.
Zweimal lobt er den Glauben der Gemeinde, zuerst im Eingangsstück mit den Worten: "Euer Glaube ist gerühmt in der ganzen Welt" (Röm. 1,8), dann aber besonders im Schlussstück des Briefe (Röm. 16,19), wo er den Glauben der Kirche rundweg als vorbildliche Gehorsamsleistung erklärt, die allen bekannt sei.
Auch setzt Paulus wie in den von ihm gegründeten Kirchen auch in der römischen das Dasein und die Bestätigung geordneter Lehrcharismen voraus (Röm. 12, 4-8). Der Apostel betont, dass die Römer zu seiner großen Freude eine Glaubensvollendung erreicht hätten, die ihnen ein selbständiges Urteil über gefährliche Neuerungen in Glaubenssachen gestatte (Röm. 16,19).
Aber nicht alle betrachteten das Emporwachsen des kleinen Senfkörnleins zu allbeschattenden Baum mit Wohlwollen. Gewisse national-jüdische Kreise verfolgten es mit eifersüchtiger Gehässigkeit. Es kam deswegen im römischen Ghetto zu Zwistigkeiten zwischen den christus- und den andersgläubigen Juden, die zu heftigen Tumulten und tätlichen Zusammenstößen führten, so dass sogar Kaiser Claudius darauf aufmerksam wurde.
Wie uns sein Biograph Suetonius in der Vita Claudii berichtet, wies er im Jahre 49 die Juden aus Rom aus. Das Ausweisungsedikt des Claudius bedeutete, da es natürlich auch die christlichen Juden betraf, für die römische Christenheit einen empfindlichen Schlag. Auch Petrus, der Vater der Gemeinde, und das judenchristliche Ehepaar Aquila und Priscilla mussten Rom verlassen. Während dieses nach Korinth flüchtete (Apg. 18,2), begab sich Petrus nach Jerusalem.
Als man sich lange gestritten hatte, stand Petrus auf
Groß war die Freude der Urgemeinde in Jerusalem, als Petrus nach langer Abwesenheit in Rom "ins Haus der Maria, der Mutter des Johannes Markus" (Apg. 12,12) auf dem Berge Sion zurückkehrte, das er, um dem Henkersschwert des Herodes zu entgehen, vor sieben Jahren, in jener denkwürdigen Osternacht, bei seiner Flucht verlassen hatte.
Es war eine seltene Gemeindefeier, als Simon, Bar-Jona, vor der Versammlung der Gläubigen von seinem reichen Fischzug in der Stadt am Tiber erzählte, wie das Christentum dort Anker geworfen habe und die römische Christengemeinde groß und mächtig geworden sei, ein leuchtendes Beispiel für die Gemeinden der ganzen Welt.
Aber der Aufenthalt in der Heiligen Stadt war für den Menschenfischer aus Kapharnaum nicht nur eine Zeit der Freude, der Erquickung und der behaglichen Ruhe. Eine schwere Sorge lastete auf ihm: im Fischernetz, das der Herr ihm anvertraut und das er über die Meere ausgeworfen, hatte sich ein gefährlicher Knäuel gebildet, den zu entwirren, ohne dass die Maschen rissen, viel Geduld und große Geschicklichkeit erforderte. Zwischen Juden- und Heidenchristen war ein heißer Prinzipienkampf entbrannt, der seit der Aufnahme des heidnischen Hauptmanns Cornelius in die Kirche nicht mehr zur Ruhe gekommen war, sondern sich immer mehr zugespitzt hatte und nun zu einer Entscheidung dränge (Apg. 15,1-35; Gal.2,1-10).
Der Streit wurde ausgelöst von einigen Mitgliedern der Pharisäerpartei in Jerusalem, die zum Christentum übergetreten waren, aber mit dem Pharisäerrock keineswegs auch den Pharisäergeist jüdischer Vorurteile abgelegt hatten. Von der Spannweite christlichen Glaubens, vom Geistesbrausen des Pfingstfestes hatten sie kaum einen Hauch verspürt.
Sie wollten das Rad der Geschichte zurückdrehen und die Kirche in eine Art jüdische Mission zur Proselytengewinnung umwandeln. Ihre konservative Enge drohte die junge Heidenkirche wieder in die frühere, unbewegliche Gesetzesstrenge zurückzudrängen.
Als Paulus und Barnabas von ihrer ersten Missionsreise nach Antiochien am Orontes zurückkehrten und dort von ihren gewaltigen Erfolgen unter den Heiden berichteten, "dass Gott auch den Heiden eine Türe zum Glauben aufgetan habe" (Apg. 14,27), kamen diese judaisierenden Quertreiber - "falsche Brüder" (Gal. 2,4) nennt sie Paulus - aus eigenem Antrieb, ohne jeden kirchlichen Auftrag nach Antiochien herab und versuchten die "Türe zum Glauben", die Gottes allerbarmende Gnade weit aufgetan hatte, wieder zu verrammeln, indem sie sich auf Jakobus beriefen und erklärten: "Wenn ihr euch nicht nach mosaischer Sitte beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden " (Apg. 15,1).
Eine ungeheure Aufregung bemächtigte sich darauf der Heidenchristen in Antiochien. Es kam zwischen Paulus und Barnabas einerseits und diesen engherzigen Gesetzesfanatikern andererseits zu stürmischen Auseinandersetzungen. Da man von der Rückkehr des Petrus nach Jerusalem gehört hatte, beschloss die Gemeinde, Paulus und Barnabas und einige andere ihrer Richtung nach Jerusalem zu senden, damit dort durch die höchste Autorität, durch Petrus, eine grundsätzliche Entscheidung in dieser Frage herbeigeführt werde.
In Jerusalem angekommen, wurde Paulus mit seinen Begleitern, unten denen man auch Titus, einen seiner treuesten Schüler, bemerkte, ins Abendsmahlshaus auf dem Berge Sion geführt und von der Urgemeinde, den Aposteln und Ältesten freundlich begrüßt. In atemloser Stille lauschten die Gläubigen dem Bericht der Missionare. Viele Gesichter zeigten unverhohlene Freude über die Nachricht von der Bekehrung der Heiden.
Es waren aber auch andere darunter, diejenigen der Judaisten und Pharisäerkonvertiten, die sich im Laufe der Erzählung merklich verfinsterten. Nicht einmal die Tatsache, dass der Heilige Geist selbst zugunsten der Heiden entschieden hatte, verfing bei diesen Starrköpfen.
Erneut traten sie mit der Forderung auf: "Man muss sie beschneiden und anhalten, dass sie das Gesetz des Mose beachten" (Apg 15,5). Die Begrüßungsversammlung, die so würdevoll begonnen hatte, artete in eine stürmische Debatte aus. Man ging aus dem Abendmahlssaal, in dem der Herr einst zu seinen Jüngern gesprochen hatte: "Frieden hinterlasse ich euch, ja, meinen Frieden gebe ich euch " (Joh. 14,27), in Unfrieden und Zerwürfnis hinweg.
In dieser Schicksalsstunde, in der die junge Gemeinde in eine Judenkirche und eine Heidenkirche auseinanderzufallen drohte, berief Petrus als Oberhaupt der Christenheit eine besondere Sitzung ein, das sogenannte Apostelkonzil, das wiederum im Abendmahlshaus stattfand und bei dem nicht die Gemeinde, sondern nur die Apostel und die Ältesten mit den Abgesandten von Antiochien zugegen waren.
Die beiden Parteien prallten wiederum scharf aufeinander. Die Funken sprühten hinüber und herüber. Die leidenschaftlich erregte Diskussion dauerte lange. Paulus besonders legte seine Auffassung mit aller Heftigkeit dar. Plötzlich aber trat Stille ein. Der ausschlaggebende Mann beim Konzil stand auf.
Kephas, das Haupt der Urapostel, ergriff als erster das Wort, und es ist zugleich das letzte Wort, das uns Lukas von ihm berichtet. Wie ein Mann, der Macht und Ansehen hat, begann Kephas zu sprechen: "Ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott schon vor längerer Zeit in eurer Mitte die Entscheidung getroffen hat, dass die Heiden durch meinen Mund das Wort der Frohbotschaft vernehmen und zum Glauben kommen sollten.
Und dieser Gott, der die Herzen kennt, hat auch Zeugnis für sie abgelegt: denn er hat ihnen den Heiligen Geist gegeben, genau wie uns. Er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen: durch den Glauben reinigte er die Herzen. Nun denn, was versucht ihr Gott? Weshalb wollt ihr dem Nacken der Heidenchristen ein Joch aufbürden, das weder unserer Väter noch wir zu tragen vermochten? Nein, wir glauben vielmehr, dass alle - wir wie auch jene - in ganz gleicher Weise durch die Gnade des Herrn Jesus das Heil erlangen." (Apg. 15,7-11).
Petrus hatte damit ausgesprochen, was seit Monaten und Jahren in den Herzen vieler Gläubiger gewesen war, wenn sie auch nicht gewagt hatten, es zu sagen. Die Worte des hochangesehenen Apostels bedeuteten eine autoritative Entscheidung, und Gegenargumente waren hier fehl am Platze. Sein Beschluss wurde mit respektvollem Schweigen aufgenommen. "Da schwieg die Versammlung", sagt die Apostelgeschichte, "und hörte auf Barnabas und Paulus, die erzählten, welch große Zeichen und Wunder Gott unter den Heiden durch sie gewirkt hatte." (Apg. 15,12).
Auch Jakobus, der Vertreter des gesetzestreuen Judenchristentums, stimmte dem Urteil des Kephas bei. Er ergriff das Wort, um die Entscheidung Petri der judaistischen Partei, die schweigend und reglos, wie vom Blitz getroffen da saß, näherzubringen (Apg. 15,14-18) und praktische Vorschläge zu machen, die geeignet waren, die religiösen Gefühle der Judenchristen zu schonen (Apg. 15,19-21).
Es kam in den strittigen Punkten eine Übereinkunft zustande, die zwei Fragen entschied: die Heidenchristen sind frei vom Joch des Gesetzes; andererseits sollen sie, um die Gewinnung der Juden zum Evangelium zu erleichtern, sich in drei den Juden besonders anstößigen Punkten einschränken: erstens sollen sie sich des Götzenopferfleisches enthalten, zweitens Unzucht meiden und drittens auf den Genuss tierischen Blutes in jeder Form verzichten.
Judas Barsabas aus Jerusalem, einer der ersten Christen, und Silas oder Silvanus, ein aus der Diaspora stammender Hellenist mit einem jüdischen und einem lateinischen Namen, überbrachten diesen Entscheid in einem apostolischen Sendschreiben der Gemeinde am Orontes, wo er mit unbeschreiblicher Freude aufgenommen wurde.
Als Kephas nach Antiochien kam...
Als die Konzil Teilnehmer von Jerusalem abgereist waren, ließen die jüdischen Extremisten Kephas spüren, dass sie ihm seinen Entscheid bei der Apostelzusammenkunft zugunsten der Heidenchristen übelgenommen hatten. Zwar anerkannten sie ihn nach wie vor in seiner einzigartigen Vorrangstellung als Princeps Apostolorum und Primas der jungen Christenheit. Aber sie gaben ihm bei jeder Gelegenheit deutlich zu verstehen, dass sie sich innerlich mit seinem Vorgehen keineswegs abgefunden hatten. Im Gegenteil, sie wachten nur um so eifriger über die Einhaltung des Gesetzes und betrieben nur um so eifriger Propaganda.
Petrus spürte die Erregtheit und Unzufriedenheit, den Unmut und Ingrimm dieser Kreise, die ihm entgegenwirkten. Die Unbrüderlichkeit dieser Brüder erschwerte ihm seine Arbeit sehr. Ihre Wühlereien und Quertreibereien verleideten ihm den Aufenthalt in Jerusalem von Tag zu Tag mehr. Am meisten bedrückte es ihn, dass er bei der neuen Lage der Dinge unter der palästinensischen Juden nicht mehr wirken konnte und der Erfolg ihm unter ihnen mehr und mehr versagt blieb. Ob das nicht vielleicht ein Wink Gottes war, Jerusalem und das Judenland für immer zu verlassen und sich anderswohin zu begeben?
Unwillkürlich richteten sich seine Gedanken nach Rom. Dort sah er das Feld seiner nächsten Wirksamkeit. Eines Tages fasste Kephas den Plan, nach der Hauptstadt der Welt zurückzukehren. Auf dem Wege dorthin wollte er den Brüdern in Antiochien einen Besuch abstatten.
Nach einer Reise von ungefähr drei Wochen betrat Petrus in Begleitung des Markus die Weltstadt am Orontes. Durch das Getriebe der belebten Straßen schlugen die beiden Männer den Weg nach dem Quartier des Barnabas ein. Bald waren hier die Häupter der jungen Christengemeinde versammelt. Die Ankunft des Kephas, der auch hier eine überragende Autorität besaß, wurde allerseits mit Freuden begrüßt.
Die Antiochener waren stolz, das verehrte Oberhaupt der Kirche in ihrer Mitte zu sehen. Petrus seinerseits war tief beeindruckt vom Bild, das sich ihm darbot. Wie wohltuend hob sich doch diese junge, begeisterte Christenschar ab vom dunklen Hintergrund der heidnischen, leichtlebigen und dem Sinnengenuss hingegeben Weltstadt.
Wie erhebend erschien ihm inmitten der tausendfachen Lobgesänge auf Aphrodite und alle die Götter und Göttinnen des Genusses, von denen ganz Antiochien widerhallte, der freudige Dankespsalm der Heidenchristen, den er in diesem Kreise vernehmen durfte. Hier zeigte sich, welcher Veredlung diese von den Juden so verachteten Heiden fähig waren, nachdem sie sich Christus angeschlossen hatten.
Petrus war entzückt von der inneren Freiheit dieser Menschen, die so fröhlich hineingriffen in die Gnadenschätze Christi, weil ihnen die eingebildete Gesetzesgerechtigkeit der Juden fehlte. Ohne Bedenken schloss er sich der Ortssitte an und verkehrte in der sorglosesten Art in den Familien. Er nahm an den gemeinsamen Mahlzeiten am Sabbatabend teil, welche in ihrem Brudersinn die beste Vorbereitung auf das eucharistische Abendmahl bildeten.
Er war wegen des Speisezettels recht unbekümmert und fragte nicht, ob die Speisen nach jüdischem Gesetz rein oder unrein seien und wies auch Hühnerbraten, Schweinefleisch oder etwa einen Aal aus dem Orontes nicht zurück.
So verbrachte Kephas glückliche Tage in Antiochien,