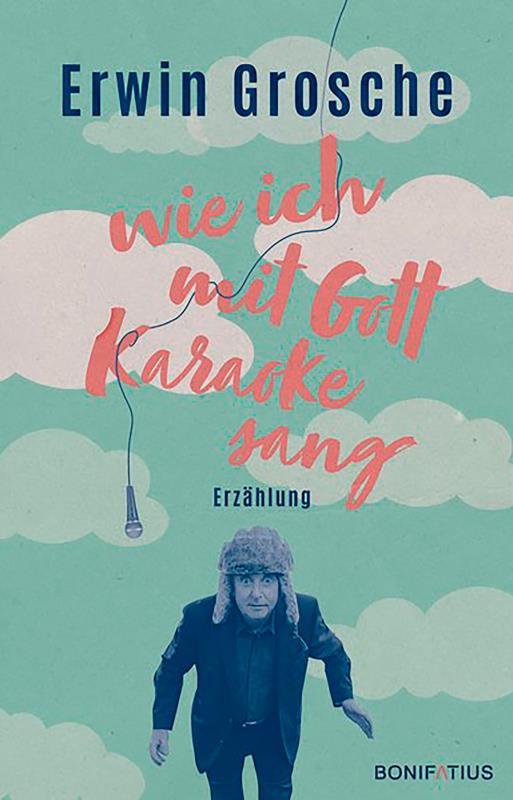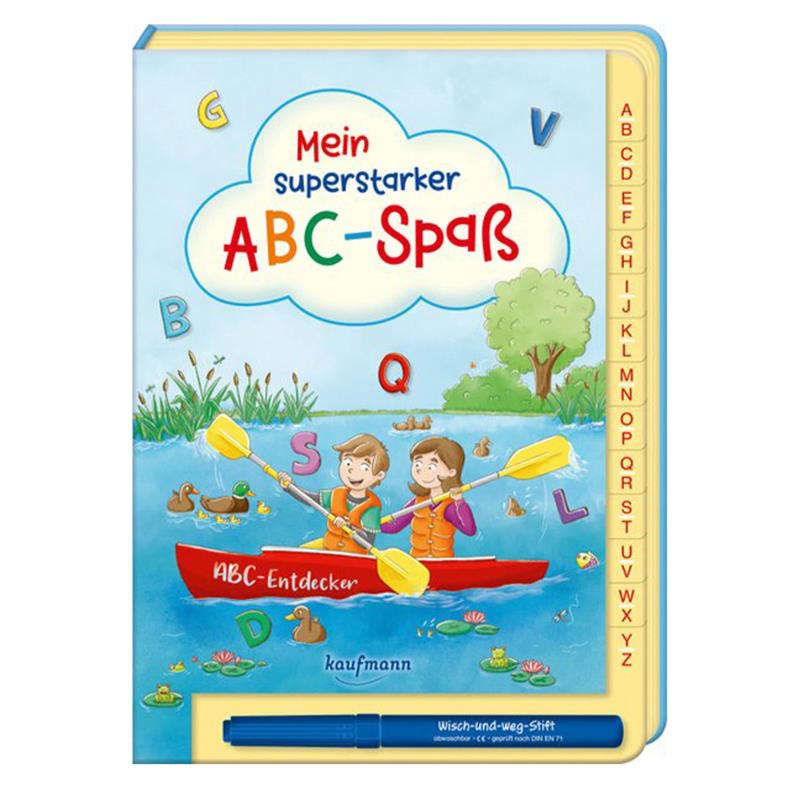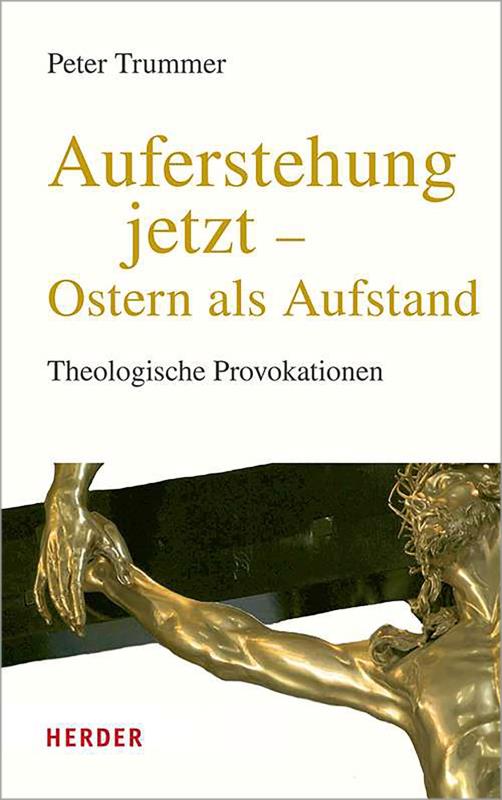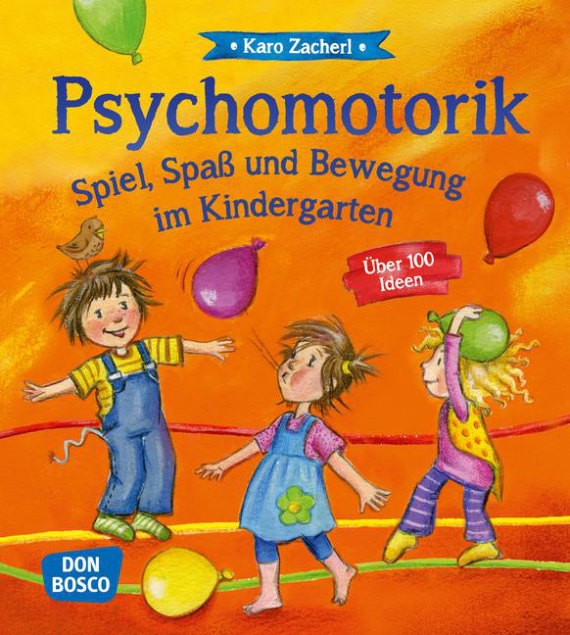Lustiges
Humorvolle Gedichte zum Schmunzeln und herzhaften Lachen. Viele sind zum Vortragen für Geburtstagsfeiern geeignet, andere bieten sich zur allgemeinen Erheiterung an.
Freuen Sie sich an den lustigen Gedichten und teilen Sie sie gerne mit anderen – denn Christ sein bedeutet: fröhlich sein!

Gott vertrauen
Ein Freund traf einen Zimmerman.
So traurig? Sag, was ist geschehen?
Der sah den andern weinend an:
Wenn du es hörst, wirst du verstehen.
Ich muss auf meines Herrn Befehl,
soll ich mein Leben nicht verlieren,
elftausend Säcke Sägemehl
für ihn bis morgen produzieren.
Der andere umarmte ihn.
Lass uns den nächsten Tag vergessen.
Noch weit entfernt ist der Termin.
Wir wollen feiern, trinken, essen.
Gott wird, wenn wir ihm nur vertraun,
für uns des Kommenden gedenken.
Wir woll’n auf seine Güte baun,
und was wir brauchen, wird er schenken.
Sie lenkten heimwärts ihren Schritt,
mit Jammer und Geschrei empfangen.
Die Tränen stillten sie damit,
dass sie nun tranken, tanzten, sangen.
Darauf begann des Tischlers Weib
Zu weinen über die Beschwerden:
Wir haben frohen Zeitvertreib,
doch bald sollst du enthauptet werden.
Der Tischler sprach: Nimm’s nicht so schwer!
Noch leben wir vergnügt und heiter.
Lass uns so tun, als ob nichts wär.
Vertrau auf Gott! – Das Fest ging weiter.
Sie tanzten an des Abgrunds Rand.
Doch als der der nächste Morgen graute,
nahm die Besorgnis überhand.
Voll Angst man hin zur Haustür schaute.
Der Bote kam beim Morgenrot.
Die letzte Hoffnung sank in Trümmern.
Der König, sagte er, ist tot.
Du bist bestimmt, den Sarg zu zimmern.
Dies scheint beinahe wie ein Bild
Für Spannung, die nicht aufzuheben:
Der Tod gebärdet sich wie wild,
doch letzten Endes siegt das Leben.
Ein Mensch steht erst für sich allein.
Er kann den Anspruch nicht erfüllen.
Von überall zu seiner Pein
Verbote und Gebote schrillen.
Und Finsternis bedeckt die Welt.
Entfaltung wird erstickt durch Zwänge.
Die Lebensfreude ist vergällt.
Ringsum Bedrängnis, Grenzen, Enge.
Da kommt ein andrer auf ihn zu,
bereit sogar, mit ihm zu leiden.
Der Unbekannte wird zum Du,
und nichts kann dieses Band zerschneiden.
Sie feiern angesichts von Leid,
trotz Zweifeln, Todesdrohung, Sorgen,
ja, gegen Gottverlassenheit
in Hoffnung auf ein bess’res Morgen.
Christoph Hartlieb
Glück und Reichtum
Noch glücklicher
Dass Menschen glücklich werden wollen,
dafür soll keiner ihnen grollen.
Was wär‘ an diesem Wunsch verkehrt?
Das Leben wär‘ nicht lebenswert,
bekäm man nicht ein kleines Stück
vom allgemeinen Menschenglück.
Doch vielen ist dies nicht genug
in ihrem Superhöhenflug.
Sie können ihren Wunsch nicht zügeln
und woll’n die andern überflügeln.
Ist jemand so unendlich gierig,
dann wird es nämlich häufig schwierig,
weil er die andern auf der Welt
für glücklicher und reicher hält,
als es bei noch so hellem Licht
der wahren Wirklichkeit entspricht.
Deshalb, o Mensch, wird richtig glücklich
in Zukunft oder augenblicklich.
Doch höre auf, Dich zu vergleichen
mit andern Glücklichen und Reichen.
Christoph Hartlieb
Verschenkter Reichtum
Ein Reicher, der in Reichtum schwimmt,
doch geizig ist, und zwar sehr arg,
in seinem Testament bestimmt:
Legt mir viel Geld in meinen Sarg!
Als ihn der Weg zum Himmel führt,
sieht er ein Essen auf dem Tisch,
und weil er starken Hunger spürt,
fragt er: Was kostet dieser Fisch?
Nur einen Pfennig, hört er da.
Wie gut, ich hab genügend Geld.
Und dieses Fleisch mit Paprika?
Auch einen Pfennig, wenn’s gefällt.
Wie billig, da der Reiche denkt.
Doch dann erschrickt er schauderhaft.
Hier gilt nur, was ein Mensch verschenkt,
und nichts von dem, was er errafft.
Christoph Hartlieb
Mehr
Wer wenig hat, zeigt der Befund,
ist oft zufrieden und gesund,
was er auch weiter bleiben könnte,
wenn er sich Rast und Ruhe gönnte.
Doch lässt er’s nicht bei dem Vergnügen
und sucht noch etwas mehr zu kriegen,
vermutend, habe er erst mehr,
dann sei er noch viel glücklicher.
So müht er sich mit aller Kraft,
dass er sich mehr und mehr beschafft.
Besitzt er mehr, dann stellt er fest,
es fehlt ihm immer noch ein Rest,
und meint, dass er sich mehr erlabe,
wenn er noch mehr von allem habe.
Er hetzt und wühlt und rafft und schwitzt,
bis er tatsächlich mehr besitzt.
Dann ärgert er sich schief und platt,
dass irgendeiner noch mehr hat.
Warum denn ausgerechnet der?
Er hat genug. Ich brauche mehr.
Deswegen fängt er wieder an,
obwohl er fast schon nicht mehr kann.
Wenn er ein bisschen mehr noch hätte…
Fast endlos dauert diese Kette,
und weiter geht’s auf altem Gleis
im sogenannten Teufelskreis.
Stets schneller dreht sich die Spirale,
erst einmal und dann viele Male,
bis ihm die Welt vor Augen flimmert
und er von Angst gepeinigt wimmert.
Das Drama endet tränenschwer,
denn er ist tot und kann nicht mehr.
Das letzte Hemd hat keine Taschen,
er kann das Geld nicht mehr vernaschen.
Er ruht in einem Blumenmeer,
doch ringsum ist es kalt und leer.
Darum die Mahnung des Gedichts:
Wer alles will, bekommt oft nichts.
Der Reichtum wird nicht ewig dauern.
Es werden wenige nur trauern.
O Mensch, es lacht bei deinem Sterben
dafür der Teufel und die Erben.
Gib lieber vorher ein paar Spenden,
freiwillig und mit warmen Händen.
So säst du Wohlgefühl und Glück,
und dies fällt auf dich selbst zurück.
Begnüge dich mit weniger.
Dann hast du letzten Endes mehr.
Christoph Hartlieb
Tücke der Technik
Die Segnungen der Technik sind
geläufig heute jedem Kind,
wogegen ält're Kandidaten
oft in Bedrängnisse geraten.
Man möchte ja und kann mitnichten
auf die Bequemlichkeit verzichten,
die Auto, Büchsenöffner, Wecker,
Lift, Rasenmäher, Dreifachstecker,
Musikverstärker, Waschmaschine,
Motorrad, Föhn, Füllhaltermine,
Staubsauger, Mixer, Telefon,
Computer und Television
dem bieten, dem es auch gelingt,
dass er sie in Bewegung bringt
und, wenn die Neigungen erkalten,
versteht, sie wieder abzuschalten.
Es ist da ein bestimmter Knopf,
den hat er zwar in seinem Kopf
als Leser der Gebrauchsanweisung,
jedoch als Opfer der Vergreisung,
ja selbst im frühen Mittelalter,
weiß er dann doch nicht, welchen Schalter
er erst betätigt oder drückt,
damit, was er erwartet, glückt
und nicht, falls er womöglich zieht,
genau das Gegenteil geschieht.
Soll's langsam gehn, geht's plötzlich schnell,
es wird nicht dunkel, sondern hell;
erhofft er's leise, brüllt es laut,
statt Apfelmus kommt Sauerkraut,
zwei Schritte vorwärts, drei zurück,
mit einem Wort, er hat kein Glück.
Es knackt und knallt, es zirpt und zischt,
der Körper kriegt eins ausgewischt,
sodass er sich geschmeidig krümmt
und rings die Welt in Dampf verschwimmt.
Der Mensch, der sich so dumm betrug,
wird aus dem Schaden auch nicht klug.
Gefragt ist jetzt Expertenwissen
zwecks Abschaffung von Hindernissen,
weil jeder, der danebengreift,
leicht aus dem letzten Loche pfeift.
Er schleppt sich, halb betäubt vor Kummer,
zum Telefon, dreht eine Nummer
und hört sehr knapp und unumwunden,
er sei verrückt und falsch verbunden.
Darauf versucht er's, tief verletzt,
erneut, doch diesmal ist besetzt.
Spät abends, denn er kann's nicht lassen,
kriegt er den Meister selbst zu fassen.
Der teilt ihn mit:„Es tut mir leid,
ich habe wirklich keine Zeit.“
Er, der bisher auf den Komfort
der technischen Entwicklung schwor,
beschließt, die Technik zu verfluchen
und ein Korallenriff zu suchen,
auf dem er in der Sonne brät
ganz ohne Elektrizität.
Christoph Hartlieb
Tierische lustige Gedichte
Huhn und Hund
Fast jeder wünscht sich ungemein,
wertvoll für andere zu sein.
Es kann ihn fürchterlich betrüben
zu hörn, dass ihn nicht alle lieben.
Noch ärger ist’s, wenn er erfährt,
er tauge nichts und sei nichts wert.
Drum sucht er anderen und sich
fortwährend und geflissentlich
den eignen Nutzen zu erhellen
und sich ins rechte Licht zu stellen.
Es wäre ihm am liebsten, ehrlich,
man hielte ihn für unentbehrlich.
So zeigt sich’s auch in dieser Fabel
vergnüglich, deutlich und passabel:
Ich frage mich, aus welchem Grund,
spricht da ein Huhn zu einem Hund,
wirst du vom Menschen so verwöhnt,
dass überall dein Lob ertönt? –
Ich spende Federn für sein Bett
und Eier für sein Omelett.
Mein Fleisch kann delikat geraten
beim Kochen, Grillen oder Braten.
Was aber hat der Mensch von dir,
du ganz und gar nutzloses Tier?
Worauf der Hund gemessen spricht:
Das, dummes Huhn, verstehst du nicht.
Ich bin sein Freund, und das ist mehr,
als wenn ich noch so nützlich wär.
Christoph Hartlieb
Raupe und Schmetterling
Gar mancher ist recht unzufrieden
mit dem Geschick, das ihm beschieden.
Wie er sein Leben führen muss,
scheint nichts als Elend und Verdruss.
Doch jedem andern geht es gut,
obwohl er gar nichts dafür tut.
Das Schicksal ist so ungerecht
und diese Welt so furchtbar schlecht.
Ob dies so ist, macht eine Fabel
bedenkenswert und diskutabel.
Die Raupe spricht zum Schmetterling:
Mein Ärgernis ist nicht gering.
Du führst, von bunter Pracht umgeben,
ein herrliches Genießerleben.
Du trägst ein wunderschönes Kleid.
Von aller Hässlichkeit befreit
saugst du den Nektar aus den Blüten,
die stolz sind, dir sich darzubieten.
Jedoch vor mir und meinesgleichen
scheinst du voll Ekel auszuweichen.
Was gibt es Schlimmeres auf Erden,
als so vernachlässigt zu werden? –
Du irrst dich, spricht der Schmetterling,
weil mir es einst wie dir erging.
Musst du vielleicht bisher noch leiden,
du brauchst mich trotzdem nicht beneiden.
Es wird dir so wie mir ergehn,
bald wirst du bessre Zeiten sehn.
Was jetzt geschieht, ist nur ein Stück
des langen, schweren Wegs zum Glück.
Christoph Hartlieb
Böse Zungen
Seit Moses Zeiten gilt für jeden:
Du sollst nicht falsches Zeugnis reden:
nicht aus Vermutung und Verdacht,
geschweige denn aus Niedertracht.
Du sollst nicht lügen und betrügen,
um andern Schaden zuzufügen,
nicht schwindeln, täuschen, denunzieren,
bösartige Gerüchte schüren
und alles nach dem Motto mengen:
Ein bisschen bleibt ja immer hängen,
womöglich ausgerechnet dann,
wenn sich der Mensch nicht wehren kann.
Einleuchtend schildert diesen Fall
Die Fabel von der Nachtigall.
Nachdem sie lange herrlich sang,
wird sie erst matt und schließlich krank.
Zum Singen fehlt ihr Lust und Kraft.
So lässt sie, was sie nicht mehr schafft.
Die Spatzen bringen sich halb um:
Sie ist zu faul, zu schwach, zu dumm,
worauf sie, innerlich verletzt,
erneut zu einem Lied angesetzt.
Nicht lange dauert’s. Aus der Traum!
Entseelt stürzt sie vom Apfelbaum.
Da zetern alle Spatzen los:
Warum singt dieser Vogel bloß?
Wer krank ist, muss sich eben schonen!
Doch sie singt lieblich Kanzonen.
Christoph Hartlieb
Wichtigtuerei
Ein jeder Mensch, so heißt es richtig,
sei unersetzlich, wertvoll, wichtig,
wenn er sich selber wichtig nimmt.
Doch wird es komisch und gefährlich,
hält er sich selbst für unentbehrlich.
Dies demonstriert auch eine Fabel
genauso deutlich wie blamabel:
Ein Vogel liegt aus freien Stücken
bewegungslos auf seinem Rücken,
die Beine starr emporgestreckt.
Ein anderer Vogel fragt erschreckt:
Was tust du? Geht es dir nicht gut?
Darauf der erste, fast voll Wut:
Wozu stellst du die dumme Frage?
Du siehst, dass ich den Himmel trage,
und zittere auch nur ein Bein,
dann stürzte gleich der Himmel ein.
Der Vogel hat gesprochen kaum,
da fällt ein Blatt vom nahen Baum,
worauf er seine Pflicht verflucht
und angsterfüllt das Weite sucht.
Der Himmel wankt und zittert nicht,
geschweige, dass er niederbricht.
Er lächelt blau und fern und heiter
Und wölbt sich majestätisch weiter.
Christoph Hartlieb
Ordnungsliebe
Herr X, der Ordnung liebt und hält,
weil ihm die Unordnung missfällt,
die seinen Schönheitssinn ankratzt
wie einer, der beim Essen schmatzt,
bemüht sich mit geballter Kraft,
um nicht zu sagen, Leidenschaft,
all der Gewalten Herr zu werden,
die diese Ordnung stets gefährden.
Es glückt ihm in gewissen Fällen,
ein bisschen Ordnung herzustellen.
Er merkt jedoch im eignen Haus
mit Widerwillen, ja mit Graus,
dass er, der jedes Chaos hasst,
versinkt in Plunder und Morast
und rettungslos in dem ersäuft,
was sich auf seinem Schreibtisch häuft.
Der Briefträger scheint wie besessen,
Geschriebenes hereinzupressen
durch jenen Schlitz, der extra blieb,
falls wieder einer etwas schrieb;
der allerdings auch alles schluckt,
was, hunderttausendfach gedruckt,
in Wort und Bildern ihm beweist,
er sei veraltet und vergreist,
wenn er sich nicht dazu entschließt,
dem zu gehorchen, was er liest.
Wär's wenigstens ein Formular
von einem Anwalt und Notar,
sein Onkel habe vor dem Sterben
bestimmt, er solle alles erben.
Wär's ein verschämter Liebesbrief,
der ihn zu der Geliebten rief.
Wär's lediglich ein Gruß, ein knapper,
mit noch so nichtigem Geplapper,
den ihm Amanda, seine Tante,
aus Rio de Janeiro sandte.
Wär's aus der Ferne oder Nähe
besorgtes Fragen, wie's ihm gehe,
er läse dies in vollen Zügen
und ungeheucheltem Vergnügen.
Doch leider, die gedruckten Worte
sind nicht von der gewünschten Sorte,
falls er sie nicht zuvor zerreißt
und gleich in den Papierkorb schmeißt,
der seinerseits, zum Rand gefüllt,
nach allen Seiten überquillt.
Er staunt, wie viele Unbekannte,
an die er sich selbst niemals wandte,
teils drohend, teils vertrauensvoll,
empfehlen, was er machen soll,
zu seinem Besten selbstverständlich,
zum Nutzen jedermanns letztendlich.
Da kommt ein Sonderangebot
für leckeren Gesundheitsschrot,
der einerseits den Intellekt
und andrerseits den Bauch entspeckt.
Zugleich erfolgt zum dritten Male
die Mahnung, dass er Steuern zahle,
die er viel lieber selbst behielt,
statt dass der Fiskus sie ihm stiehlt.
Ein amtliches und langes Schreiben
von denen, die das Gas betreiben,
warum es nützlich sei und schön,
die Gastarife zu erhöhn.
Ein Warenhaus will Kunden locken
mit stark herabgesetzten Socken,
die ihn bewahren vor Erkalten
und mindestens acht Jahre halten.
Ein Bücherklub sucht Lesekunden,
die er bisher noch nicht gefunden,
und bietet, billig wie noch nie,
die Brockhausenzyklopädie.
Ein dicker Brief weist darauf hin,
es winke ihm der Hauptgewinn,
sofern, ja wenn er alles täte,
worum man ihn bescheiden bäte.
Die herrlichen Gewinnprodukte
verdecken fast das Kleingedruckte,
und darin lauert, wie er weiß,
der kleine Teufel des Details.
Auch Zeitschriften im Allgemeinen,
die täg- und wöchentlich erscheinen,
verhüll'n den Tisch in dicker Schicht,
so dass er fast zusammenbricht:
Hör Zu und Rheinischer Merkur,
Die Klassische Literatur,
Geheimnisse der schönen Frau
Methoden im Gemüsebau, –
und wie die Blätter alle heißen,
womit Verlage um sich schmeißen
zur Füllung ihrer eignen Kasse
und Aufklärung der dummen Masse,
von Büchern völlig abgesehn,
die teils in den Regalen stehn,
teils, weil sie auf Benutzung harren,
ihm greifbar nah entgegenstarren.
Heut soll das große Werk gelingen,
das Schreibtischchaos zu bezwingen.
Er rafft sich auf voll Zuversicht,
auf baldigen Erfolg erpicht.
Doch schnell folgt die Ernüchterung,
im Nichts verrinnt der große Schwung
wie einst bei Morgenstern Ameise
nach Antritt ihrer Chinareise.
Sie gab den Erdumrundungslauf
schon kurz nach Hamburg wieder auf.
Im Grunde geht es ihm am Schluss
so wie dem alten Sisyphus:
Hat er den Stein hinaufgestemmt,
dann rollt er, jäh und ungehemmt,
erneut hinunter in das Tal,
und wiederum beginnt die Qual.
Schon krabbelt er auf allen Vieren
verdammt zum ewigen Verlieren.
Da liegt tatsächlich noch ein Rest
vom vorvorigen Weihnachtsfest.
Auch blieb, seit er Geburtstag hatte,
so vieles auf der Schreibtischplatte,
wovon er Tag und Nächte träumt,
es wäre endlich aufgeräumt.
Er hört es an der Haustür knacken:
Nach innen quillt ein neuer Packen,
und wieder wächst auf seinem Tisch
der Stapel von Papiergemisch.
Wie machte Herkules denn das
im Stall des Königs Augias?
Es glückte dem Genie beizeiten,
den nahen Fluss hindurchzuleiten,
der das besagte Ärgernis
auf Nimmerwiedersehn mitriss.
Verzweifelt wühlt Herr X im Mist,
und wenn er nicht gestorben ist,
dann fischt er heute noch im Trüben.
Bei ihm sieht's aus wie Kraut und Rüben.
Christoph Hartlieb
Wahrheitssuche
Zuweilen wird dem Menschen klar:
Nichts bleibt, so wie es einmal war.
Es gilt hier unabänderlich
der Satz: Die Zeiten ändern sich.
Dass sie es tun, ist zweifelsfrei.
Der Teufel lauert im Detail.
Denn dabei gibt es ärgerliche,
kaum auflösbare Widersprüche.
Die einen sagen mit Gelächter:
Im Anbeginn war alles schlechter,
zwielichtig, dumm und primitiv,
voll Mittelmäßigkeit und Mief.
Erst heute ist es uns gelungen,
zu zähmen die Verwilderungen.
Wir haben es aus eigner Macht
auf Erden herrlich weit gebracht.
Wir werden unser Glück gestalten.
Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten.
Die anderen im Gegenteil:
Der Abstieg war total und steil.
Im Anbeginn war alles besser.
Man brauchte werde Colt noch Messer.
Es wird uns sicher bald gelingen,
uns gegenseitig umzubringen.
Wir haben die ererbte Pracht
im Lauf der Zeit kaputtgemacht
und werden diesen Globus spalten.
Das Ende ist nicht aufzuhalten.
Die Wahrheit liegt, so sagen Dritte,
hier wie woanders in der Mitte.
Der Dichter, jedes Wahns beraubt,
er wiegt sein weißes, weises Haupt.
Natürlich weiß auch er nicht mehr
und Klügeres als irgendwer,
obwohl ihn, wie es üblich ist,
gelegentlich die Muse küsst
und ihm auf wundersame Art
Geheimnisvolles offenbart.
Er wiegt sein Haupt, wie schon gesagt,
und macht nun auf die Wahrheit Jagd.
Sie liegt, vielleicht, es könnte sein,
wer weiß es schon genau, im Wein,
so wie er’s im Gymnasium las
ganz knapp: In vino veritas.
Er weiß, dass Sprichwörter der Alten
gehäufte Weisheiten enthalten,
und zieht die Folgerung: zum Spaß
genehmige ich mir ein Glas.
So komm ich sicherer und eher
der eigentlichen Wahrheit näher.
Gesagt, getan. Der Korken knallt.
Weg frei dem wahren Sachverhalt!
Er lässt die Flüssigkeit nach innen
ins Dunkel seiner Kehle rinnen
und harrt der kommenden Erleuchtung
aufgrund empfohlener Befeuchtung.
Jedoch die Wahrheit bleibt verschleiert,
anstatt dass sie Triumphe feiert.
Es tut sich nichts, und er beschließt,
dass er noch mehr des Weins genießt,
damit er gleichsam mit der Flasche
die Wahrheit banne und erhasche,
wie’s irgendwo im Märchen heißt
vom sogenannten Flaschengeist.
Der Zeiger dreht sich an der Uhr.
Von Wahrheit nirgends eine Spur.
Er kippt den Wein in seinen Schlund
und stößt hinab zum Flaschengrund,
jedoch trotz aller Zuversicht,
zum Grund der Wahrheit stößt er nicht.
Im Gegenteil, so konstatiert er,
die Sache wird noch komplizierter,
weil schließlich das Gefühl entsteht,
dass sich, was vorher feststand, dreht,
und jemand ohne Fundament
ohnmächtig ins Verderben rennt.
Die Wahrheit scheint nach allen Seiten
ins Wesenlose zu entgleiten.
Um welches Thema ging es doch?
Die Wahrheit scheint ein Riesenloch,
ein Nichts, von Seiendem umringt,
wo alles in den Abgrund sinkt.
Er ahnt es, spürt es, kann es schmecken,
dort in der Tiefe muss sie stecken.
Er braucht, um sie herauszuschürfen,
nur noch ein wenig Wein zu schlürfen,
dann findet er im Bodensatz
den goldenen vergrab‘ nen Schatz,
den sogenannten Stein der Weisen,
den seine Sehnsüchte umkreisen.
Er schlürft und schluckt, er schürft und scharrt,
die Wahrheit bleibt im Nichts erstarrt.
Die Gegenwart verschwimmt im Rauch,
Vergangenheit und Zukunft auch,
wo Kundige im Trüben fischen
und Gut und Böse sich vermischen.
Nur eines zeigt sich klipp und klar:
Auch dies bleibt nicht, so wie es war.
Der letzte Akt im Welttheater
Verwandelt sich in einen Kater.
Der Vorhang fällt. Im ganzen Haus
gehen Lampen und Laternen aus,
und Finsternis legt sich auf jene
schon sowieso recht trübe Szene.
Ob Wahrheit, Wunschtraum oder Schwindel –
Verschnürt bleibt das Geheimnisbündel,
worin die Wahrheit darauf ruht,
was falsch und wahr ist, schlecht und gut.
Wird je, was nie gelang, gelingen,
zum Kern der Dinge vorzudringen
und sämtliche Erkenntnislücken
zu stopfen und zu überbrücken?
Dem Dichter ist’s mit einem Mal
gleichgültig, piepe und egal.
Er kuschelt sich besinnungslos
und vollgepumpt in Morpheus Schoß.
Die Wahrheit aber bleibt verborgen,
zumindest bis zum nächsten Morgen,
wenn im Gedankenlabyrinth
die Wahrheitssuche neu beginnt.
Christoph Hartlieb
Die Zunge
Ein Herrscher, tief enttäuscht vom Leben,
beschließt, die Herrschaft abzugeben.
Doch wer hat die Befähigung?
Mein Diener scheint mir noch zu jung!
Um alle Zweifel zu zerstreuen
und den Entschluss nicht zu bereuen,
lässt er ihn kommen in den Saal:
Bereite mir das beste Mal;
um nicht ein Fehlurteil zu fällen,
will ich dich auf die Probe stellen.
Ein Weilchen überlegt der Junge,
kauft dann beim Fleischer eine Zunge,
die er auf’s feinste präpariert
und seinem Herrn bei Tisch serviert.
Der zeigt sich überaus zufrieden
und ist beinahe schon entschieden.
Doch mögest du mir noch erzählen:
Was trieb dich, gerade dies zu wählen?
Ich habe damit sagen wollen:
Die Zungen können Beifall zollen,
sie können in den Himmel heben,
entschuldigen, verzeihn, vergeben.
Die Zunge kann für Gutes danken,
ermutigen, wenn Menschen schwanken.
Sie heitert auf und bringt zum Lachen
und kann sogar – zum Herrscher machen.
Der Herrscher aber flüsterte leise:
Er scheint mir doch recht klug und weise,
und laut: Bereite mundgerecht
ein Mahl mir, das besonders schlecht.
Der Diener macht sich auf im Sprunge,
kauft auf dem Marktplatz eine Zunge,
garantiert das Essen künstlerisch
und stellt es auf des Herrschers Tisch.
Der wundert sich über die Maßen
und fragt: Was ist das? Willst du spaßen?
Erkläre mir jetzt einwandfrei,
ob gut oder schlecht dasselbe sei.
Die Zungen können auch verletzen;
sie plappern, tratschen, faseln, schwätzen;
sie denunzieren und verraten,
sä’n Misstraun selbst bei guten Taten.
Die Zunge kann die Menschen richten
und seinen guten Ruf vernichten.
Sie lästert, schimpft, verflucht und droht,
sie schmeichelt und treibt in den Tod.
Der Herrscher kaut an seiner Speise.
Obwohl noch jung, bist du doch weise.
Kein Zweifel, dass ich gehen kann.
Du bist bestimmt der rechte Mann.
Nach einer Erzählung aus Kuba
Der Clown
In einem Zirkus wütet Brand.
Der Clown, geschminkt, mit bunter Mütze,
wird in das nahe Dorf gesandt,
zu alarmier’n die Feuerspritze.
Schwer atmend stürzt er in den Ort
Mit seiner traurigen Depesche
Und schreit, dass jedermann sofort
Zum Zirkus eile und ihn lösche.
Die Leute denken: Nur ein Trick,
um Werbung für die Schau zu machen,
und glauben an kein Missgeschick.
Sie schmunzeln, freuen sich und lachen.
Es wird begeistert applaudiert
Dem meisterlichen Spiegelfechter.
Der weinte, beschwört und laminiert;
Je lauter, umso mehr Gelächter.
Bis sich des Windes Richtung dreht,
und sie die Feuersglut erkennen.
Doch jede Hilfe kommt zu spät.
Der Zirkus und das Dorf verbrennen.
Man fragt sich nun: wer ist der Clown,
der kommt, um Ernstes zu verkünden?
Dem seine Hörer nicht vertraun
Und, was er sagt, als Witz empfinden?
Ist es ein normaler Christ,
bemüht, nicht immer mitzutrotten?
Den manche, weil er anders ist,
mitleidig anschauen und verspotten?
Ist es ein Pfarrer im Taler,
in schwarzen, komischen Gewändern?
Er ruft und mahnt und predigt zwar,
doch keiner hört und will sich ändern.
Ist es ein heimlicher Prophet,
den Übel unsrer Zeit ergrimmen
und dessen Stimme untergeht
in all den vielen andern Stimmen?
Ein Journalist, der kreuz und quer
Unrecht aufdeckt in Zeitungsspalten?
Ein Staatsmann, der gerecht und fair
Versucht, den Frieden zu erhalten?
Ein Arzt, der seine Kranken kennt?
Ein Tischler, der das Hausdach zimmert?
Ein Elternpaar, das konsequent
Sich um das Wohl der Kinder kümmert?
Man weiß es häufig nicht genau.
Fest steht nur: Gäb es nicht die Narren,
es seien Mann, Kind oder Frau,
das Leben würde bald erstarren.
Christoph Hartlieb
Das Honigkuchenherz
Vor der Bude beim Zuckerbäcker stand
der Opa mit seinem Enkelkind an der Hand.
Fritzchen wählte nach langem Suchen
ein großes Herz aus Honigkuchen.
Nun ging der Opa mit Fritzchen die Runde,
es dauerte schon eine ganze Stunde.
Vor jeder Bude blieb Fritzchen stehen,
überall gab es Neues zu sehen.
Plötzlich sagte er ganz leise „Opilein...
Opa, ich muss mal, auch bloß ganz klein.“
„Schon recht“, sagte der Opa, der Gute,
„komm, Fritzchen, geh einfach hinter die Bude.
Fest in der Hand den Honigkuchen
ist Fritzchen vorne das Knöpfchen am Suchen.
Der kalte Wind pfiff ihm um die Ohren,
die Fingerchen waren schon blau gefroren.
Deshalb traf er einige Male
das Lebkuchenherz mit seinem Strahle.
Das kleine Fritzchen merkte es gleich,
denn der Honigkuchen wurde ganz weich.
Danach sagte er ohne Unterlass
„Opa, mein schönes Herz ist nass!“
Da ging halt der Opa, der einzig Gute,
mit Fritzchen zurück an die Zuckerbude
und stillte den großen Schmerz
mit einem neuen Lebkuchenherz.
Nun hatte er zwei Herzen und es war ja klar,
dass eines davon nicht in Ordnung war.
Doch Fritzchen wollte sich damit nicht befassen,
und dieses den Opa entscheiden lassen.
Der Opa wusste auch hier in der Tat
gleich wieder einen guten Rat:
„Weißt Du, mein Junge, das machen wir so,
das schenken wir der Oma, die tunkt sowieso!“
Verfasser unbekannt
Die Schwachheit der Kirche
Der Teufel, so sagt die Legende,
sucht Jesus wortreich zu beschwatzen,
dass er doch nicht am Kreuze ende;
dann würde er sein Werk verpatzen:
Die Kirche braucht dich auf der Erde.
Denn wer soll predigen und heilen?
Wer hütet diese deine Herde?
Wer soll die Ämter einst verteilen? –
Ich habe Menschen ausgewählt,
die hier und an den andern Plätzen,
von meinem Geist und Mut beseelt,
es wagen, mein Werk fortzusetzen. –
Doch Petrus und Johannes werden
es niemals ganz alleine schaffen.
Es fehlt in Nöten und Beschwerden
an Stärke ihnen und an Waffen. –
Sie werden sicher andre finden,
und immer größer wird die Zahl. –
Doch alle stecken voller Sünden.
Kein einziger ist ideal.
Sie haben ihre schwachen Stellen
und lassen sich im Nu verleiten,
nicht nur die Intellektuellen
mit ihren Extraeitelkeiten,
nein auch die sogenannten Frommen
sind meist nur auf ein Ziel erpicht:
Wie sie wohl in den Himmel kommen.
Den Nächsten sehn sie dabei nicht.
Sie sind grundsätzlich undankbar.
Das Gute wird sofort vergessen.
Sie scheuen Mühe und Gefahr,
stets auf Bequemlichkeit versessen.
Sie sind vernarrt in Geld und Gut,
nichts als ein Haufen Psychopathen.
Ich rate dir, sei auf der Hut,
sie könnten gar dich selbst verraten.
Sie sind gemein und überspannt,
bereit, sich böse anzufauchen.
Es scheint mir überaus riskant,
sie für die Kirche zu gebrauchen. –
Ja, sagte Jesus, in der Tat,
ich könnte ganz und gar verlieren.
Trotzdem verwerf ich deinen Rat.
Ich will es wenigstens probieren.
Christoph Hartlieb
Kauf von Souvenirs
Es hegt der Mensch in seiner Brust,
ihm selbst vollkommen unbewusst,
das Streben, Dinge zu besitzen,
die weder nötig sind noch nützen.
Dies ist zunächst nur eine These,
und sie bedarf der Exegese,
weil jeder sonst mit Recht annimmt,
dass sie verkehrt ist und nicht stimmt.
Am klarsten lässt sie sich beweisen
bei Individuen auf Reisen,
genau gesagt, in diesem Fall
in Spanien und Portugal.
Denn ist ein Mensch im Lande fremd,
entfaltet er sich ungehemmt
und offenbart dann zur Genüge
verborgene Charakterzüge.
Die Kauflust steckt ihm tief im Blut
und wandelt sich zur Kaufeswut,
nicht nur, wie mancher Leser denkt,
aufs weibliche Geschlecht beschränkt.
Nein, jeder Mensch als Mensch muss laufen,
um, was er nicht besitzt, zu kaufen.
Gewisse Dinge muss er haben,
und deshalb fängt er an zu traben,
damit er dort, wo alles liegt,
das, was er haben möchte, kriegt.
Er tauscht Escudos und Peseten
anstelle heimischer Moneten,
erwirbt sich Decken, Silber, Hähne,
entweder diese oder jene,
stopft schwere Vinho tinto-Flaschen
in aufgebauschte Plastiktaschen,
um dann mit all den neuen Schätzen
zum Bus und ins Hotel zu hetzen.
Doch bleibt es nicht bei einem Kauf.
Es kommt im weiteren Verlauf,
wenn sich die Möglichkeiten häufen,
bestimmt zu zusätzlichen Käufen,
denn schließlich gibt es ja für jeden,
wo immer auch der Bus hält, Läden,
von Reisesouvenirs geschwollen,
die ihrerseits verdienen wollen,
und wirklich, ich verrat es Ihnen,
Geschäfte machen und verdienen.
Wenn auch das Barvermögen schmolz,
berechtigter Besitzerstolz
entfacht in menschlichen Gemütern
verstärkten Drang nach neuen Gütern.
Der Mensch blickt um sich und ist platt,
wie viel er nicht und noch nicht hat,
wie viel, sofern er sich dies gönnte,
er haben und besitzen könnte.
In seiner Brust beginnt's zu toben,
er wechselt Geld und – siehe oben.
Christoph Hartlieb
Entspannung
Wer täglich treu und wohlgemut
an jedem Tag sein Bestes tut
als Buschauffeur, Französischlehrer,
Betriebsstudent und Rauchverzehrer,
als Ärztin, Köchin, flotte Biene
und Chefin der Bürolatrine
verlangt, dass er zu seinem Wohle
sich zwischendurch davon erhole:
Entspannung, Ruhe, Atempause
vom dröhnenden Berufsgesause,
das ihn von früh bis spät umplärrt
und roh an seinen Nerven zerrt.
Die Fähigkeit, das Glück zu schmieden,
ist individuell verschieden:
Der Erste klimmt aufs Matterhorn
halb schweißgebadet, halb erfrorn.
Die Zweite taucht in Tiefseerinnen,
um Ruhm und Schätze zu gewinnen.
Der Dritte träumt im Dämmerlicht
und hofft, wer schläft, der sündigt nicht.
Die Vierte steht um fünf Uhr auf
zum Querfeldeinstaffettenlauf.
Der Fünfte futtert unbeirrt,
obwohl er dick und dicker wird.
Die Sechste darbt ununterbrochen,
obwohl beinahe Haut und Knochen.
Der Siebente verfasst Gedichte,
die Achte die Vereinsgeschichte.
Der Neunte schwärmt für Annelieschen,
die Zehnte züchtet sich Radieschen.
Der Tausenddzweiundachtzigste
erfindet einen andern Dreh,
um sich auf ungewohnten Gleisen
als Lebenskünstler zu erweisen.
Auch Dir, o Leser, will ich raten
zu ähnlichen Entspannungstaten.
Nutz jegliche Gelegenheit,
um das zu tun, was Dich befreit.
Du willst genauer wissen: Wie?
Entfalte Deine Phantasie!
Unzählig sind die Möglichkeiten,
um neue Wege zu beschreiten.
Wenn Du Erfolgserfahrung sammelst,
anstatt dass Du die Zeit vergammelst,
wird's Dir bestimmt im Handumdrehn
an Leib und Seele besser gehn.
In diesem Sinn: Ermanne Dich,
erhole und entspanne Dich!
Christoph Hartlieb
Suchen und Finden
Herr X kann aus verschied'nen Gründen
das, was er sucht, nicht immer finden,
zum Beispiel, wenn, was er vermisst,
als solches nicht vorhanden ist:
Gewissensruhe, bares Geld
und Kunst, die jedermann gefällt,
den Schnittpunkt paralleler Gleise
sowie die Quadratur der Kreise.
Da kann er noch so lange suchen
und noch so unanständig fluchen,
sein guter Wille wird zuschanden,
weil das Gesuchte nicht vorhanden.
Zum Zweiten gibt es jene Fälle,
da sucht er an verkehrter Stelle.
So sucht er ein bestimmtes Dings,
das er gern hätte, hinten links,
doch liegt es, merkt er voller Zorn,
nachdem es nichts mehr nützt, rechts vorn,
zum Beispiel etwa sein Gebiss,
der Abendstern, ein Kompromiss,
die gute Antwort beim Examen,
Verhalten gegenüber Damen, –
und alle Genialität
ist keine mehr, kommt sie zu spät.
Auch jener dritte Fall ist häufig,
dem Leser sicherlich geläufig:
Die Sache, die er sucht, ist da,
vielleicht sogar zum Greifen nah.
Er weiß genau, sie muss da sein,
doch weil so unscheinbar und klein,
ist's so, als ob sie nicht da wäre.
Er greift, im wahrsten Sinn, ins Leere.
Er lässt sich nieder auf die Knie
und schnüffelt wie das liebe Vieh,
forscht nach vom Boden bis zum Keller,
erst systematisch, darauf schneller.
Er dreht das Unterste nach oben,
beginnt gedämpft, dann laut zu toben,
die andern hätten es geklaut
und ihm den ganzen Spaß versaut.
Er tobt und stöhnt und droht und schreit:
Das tut euch sicher noch mal leid,
am Ende seines Gleichgewichts.
Das Resultat: Nullkommanichts.
Wer sucht, der findet, sagt die Bibel.
Es klingt beruhigend plausibel,
denn so entsteht ein Hoffnungsschimmer.
Er findet – allerdings nicht immer.
Christoph Hartlieb
Lustiges aus der Tierwelt
Der verstimmte Elefant
Jede Mücke hat den kleinen
Rüssel, der so oft und gerne sticht,
auch der Elefant hat einen,
aber stechen kann er damit nicht.
Deshalb ist wohl unser Riese
leider immer irgendwie verstimmt,
grade so, als ob er diese
Schwäche seinem Schöpfer übelnimmt.
Heinz Erhardt
Ente gut, alles gut
Eine Ente sitzt im Schilfe
und im Boot der Jägersmann.
Gibt‘s denn niemand, der da Hilfe
unsrer Ente bringen kann?
Schon sieht man den Hahn ihn spannen,
bums! das Schrot kracht mit Getöse,
und – die Ente fliegt von dannen.
Sie ist heiter, er ist böse.
Heinz Erhardt
Das Finkennest
Ich fand einmal ein Finkennest,
und in demselben lag ein Rest
von einem Kriminalroman.
Nun sieh mal an:
der Fink konnt‘ lesen!
Kein Wunder, es ist ein Buchfink gewesen.
Heinz Erhardt
Zwei Kröten
Zwei Kröten weiblichen Geschlechts
lustwandeln durch die Heide,
die eine links, die andre rechts,
und Warzen haben beide.
Und trotz der Warzen gehen sie
vergnüglich ihre Wege
und lachen heimlich über die
moderne Schönheitspflege.
Heinz Erhardt
Ein Nasshorn
Ein Nasshorn und ein Trockenhorn
spazierten durch die Wüste,
da stolperte das Trockenhorn,
unds Nasshorn sagte:"Siehste!"
Heinz Erhardt
Der Spatz
Es flog ein Spatz spazieren
hinaus aus großer Stadt.
Er hatte all die Menschen
und ihr Getue satt.
Er spitzte keck den Schnabel
und pfiff sich was ins Ohr.
Er kam sich hier weit draußen
wie eine Lerche vor.
Er traf hier auch manch Rindvieh,
sah auch manch Haufen Mist …
Er sah, dass es woanders
auch nicht viel anders ist.
Heinz Erhardt
Der Stier
Ein jeder Stier hat oben vorn
auf jeder Seite je ein Horn;
doch ist es ihm nicht zuzumuten,
auf so ’nem Horn auch noch zu tuten.
Nicht drum, weil er nicht tuten kann,
nein, er kommt mit dem Maul nicht ’ran!
Heinz Erhardt
Tagträume
Herr X, ist er mit sich allein,
träumt gerne in den Tag hinein.
Er sieht am Ende eines Jahres
nicht nur zurück und fragt: Wie war es?
Er starrt auch angestrengt nach vorn,
um seine Zukunft anzubohrn,
und stochert nutzlos, doch verbissen
im trüben Meer des Ungewissen.
Und weil bei dieser Wetterlage
die Aussicht auf Erfolg sehr vage,
beschreitet er zuweilen ganz
den Weg des kleinsten Widerstands:
Baut in der Luft ein Zauberschloss,
erledigt ein Rhinozeros,
schützt die Prinzessin vor dem Drachen,
wirft Zerberos aus seinem Nachen,
wiegt sich im Flug des Schmetterlings
und rettet Theben vor der Sphinx.
Er schmiedet heldenhafte Pläne,
teils diese, andrerseits auch jene,
ausgehend von dem Tatbestand,
der auch dem Leser wohl bekannt,
dass diese Welt, so wie sie ist,
die letzte Perfektion vermisst,
im Gegenteil zu seinem Groll,
sie so ist, wie sie nicht sein soll.
Weil er sich nicht damit bescheidet
und furchtbar an dem Faktum leidet,
dass Theorie und Wirklichkeit
fast unaufhörlich sind im Streit,
sucht er in seinen Phantasien
den Widersprüchen zu entfliehn.
Er brächte, wenn es nach ihm ginge,
Gesetz und Ordnung in die Dinge,
so dass, wenn man ihm Einfluss gönnte,
was ekelhaft ist, schön sein könnte.
Die Bösen schösse er zum Mond,
die Guten würden reich belohnt,
was auch bedeutete, er wär
zumindest Multimillionär.
Es bräche endlich an die Zeit
für Frieden und Gerechtigkeit,
kurzum, nach Trübsal und Beschwerden,
erschien das Paradies auf Erden.
Es ändert sich durch diesen Traum
die Welt in ihrem Sosein kaum.
Sie bleibt, an und für sich genommen,
genauso schön und unvollkommen,
so ablehn- oder annehmbar,
wie sie seit Adams Zeiten war.
Doch psychologisch gilt das nicht:
Der Traum bestärkt sein Gleichgewicht,
indem der Überdruck sich mindert,
der ihn am klaren Denken hindert.
In Wirklichkeit gilt: Nichts erreicht er,
doch innerlich fühlt er sich leichter,
und dieser Tatbestand allein,
kann auch erwünscht und nützlich sein.
So hat's, träumt einer vor sich hin,
zwar keinen Zweck, doch manchmal Sinn.
Christoph Hartlieb
Lebensrisiko
Das Leben ist, so ein Bonmot,
des Lebens größtes Risiko,
weil's, wie man es auch dreht und wendet,
normalerweise tödlich endet.
Kaum ist ein Menschenkind geboren,
erwachsen Risikofaktoren,
die, wie man sich auch kehrt und dreht,
kein Mensch auf Dauer übersteht.
Er sucht mit raffinierten Mitteln
Gefahren von sich abzuschütteln.
Das Ausgeklügeltste probiert er,
doch die Gefahr ist raffinierter,
und selbst der scharfsinnigste Schutz
ist sinnlos und zu gar nichts nutz,
wenn sich der Feind den Zugang bahnt
dort, wo sein Opfer gar nichts ahnt.
So lässt sich zwar mit Vitaminen
dem Fortschritt der Gesundheit dienen,
doch nützen sie bei aller Liebe
nichts gegen Einbrecher und Diebe.
Der Regenschirm schützt gegen Regen,
doch wenig gegen einen Degen,
beziehungsweise gegen Gift,
das uns in böser Absicht trifft.
Betonverstärkte Katakomben
sind zwar ein Schutz vor Fliegerbomben,
doch schützen sie beileibe nicht
auch gegen Schnupfen oder Gicht.
Man stolpert über'n spitzen Stein
und bricht das linke Schienenbein;
und ist es nicht das Schienenbein,
dann kann es auch das Brustbein sein;
und wer sich nicht das Brustbein bricht,
bekommt ein Pickel im Gesicht.
So schlau und unberechenbar
ist die persönliche Gefahr,
und dies, das muss ich richtigstellen,
sind noch geringe Bagatellen.
Zu diesen kommen noch die wahren
und großen Allgemeingefahren,
die, wie die Säure den Zitronen,
dem Dasein schlechthin innewohnen,
wo als gespenstiges Gespinst
der Tod schon um die Ecke grinst.
Wer Whisky, Bier und Kaffee trinkt,
ist allemal vom Tod umringt,
wie Ärzte mit besond'ren Gaben
zum Glück herausgefunden haben.
Wer Eisbein, Salz und Zucker isst,
ist ebenfalls vom Tod geküsst,
wie jede Frau und jeder Mann
in Illustrierten lesen kann.
Auch Zigaretten sind gar arg,
pro Stück ein Nagel für den Sarg,
so steht es an den Litfaßsäulen.
Schon dies genügte, um zu heulen.
Doch ist die Lage, hier wie immer,
im Grunde selbstverständlich schlimmer:
Wer atmend seine Lungen lüftet,
stirbt auch bald, von der Luft vergiftet.
Wer Fahrrad oder Auto fährt,
wer den Verkehr zu Fuß durchquert,
der ist, es tut mir herzlich leid,
dem vorzeitigen Tod geweiht.
Wer Irdischem entsagt und fastet,
wer durch die Lebensfreuden hastet,
der ist in jeglichem Bereiche
beinahe eine halbe Leiche.
Wer sich als Manager betätigt,
wer Hausfrautätigkeit erledigt,
der ist vom Tod nicht nur bedroht,
er ist bereits dreiviertel tot.
Wer an den Fingernägeln kaut,
wer seine eigne Frau verhaut,
der ist, ich möchte beinah wetten,
auf dieser Welt nicht mehr zu retten.
O Leser, die Gefahr ist groß,
jedoch der Fall nicht hoffnungslos.
Er wäre es, wenn nur die Lehre
der Wissenschaft entscheidend wäre.
Die Theorie stimmt zwar ein bisschen,
doch praktisch gibt es Kompromisschen.
Es diene Dir, ob alt, ob jung,
dies Faktum zur Beruhigung:
Des Lebens Phantasie und Kraft
ist stärker als die Wissenschaft.
Gar mancher, längst schon totgesagt,
wenn man die Wissenschaft befragt,
holt Luft, genießt, säuft wie ein Loch
und lebt tatsächlich heute noch.
Und die Moral von dem Gedicht
gibt' s, so gesteh ich, leider nicht.
Der Mensch sucht viel in seinem Leben;
nicht immer wird es ihm gegeben.
Beispiele gibt es ohne Zahl,
so unter anderm: Die Moral.
Christoph Hartlieb
Flughafen Porto 19.10.85
Ein Mensch, geneigt, um Zeit zu sparen,
zu fliegen und nicht Bus zu fahren,
erreicht den Flugplatz in dem Wahn,
hier ging's, wie anderswo, nach Plan,
er käme wie im Flug davon
die Strecke Porto-Lissabon.
Bald müsste sich ein Flugzeug zeigen,
das offensteht, um einzusteigen.
Doch die Erwartung ist verfrüht;
Es zeigt sich nur, dass nichts geschieht.
Bevor die Düsenvögel starten,
heißt's warten, warten, warten, warten.
Er sitzt herum und langweilt sich,
teils innerlich, teils äußerlich.
Die Flugbahn liegt im Schein des Lichts,
doch offensichtlich tut sich nichts,
obwohl er nach der Abflugliste
längst tausend Meter hoch sein müsste.
Das einzige, was jeder sieht,
besteht darin, dass nichts geschieht.
Da endlich schwebt ein Flugzeug ein.
Das kann und muss und wird es sein.
Zu früh ertönt das Gloria,
es fliegt nach Südamerika.
Das aber ist, wenn's auch gefiel,
nicht dieser Fahrt erstrebtes Ziel.
So sucht er sich im Warteräumchen
erneut ein Plätzchen und dreht Däumchen.
weil, wie schnell auch die Zeit entflieht,
nichts, überhaupt nichts mehr geschieht.
Im Inneren des Abflugbaues
weiß selbst die Auskunft nichts Genaues.
Sofern sie's weiß, dann hält sie dicht;
verraten darf und will sie's nicht,
so dass, bevor der Mensch abhebt,
er längst im Ungewissen schwebt.
Die Sonne klettert zum Zenit.
Er konstatiert, dass nichts geschieht.
Die Luft im Saal wird langsam dumpf,
und die Gesichter wirken stumpf.
Da plötzlich rennt wer durch die Halle,
darauf der nächste, schließlich alle,
weil irgendeine Stimme schreit:
"Zum Ausgang, schnell, es ist so weit!"
Die Freude ist nicht unerheblich,
doch leider absolut vergeblich.
Enttäuscht setzt er sich wieder hin.
Die Lage ist wie zu Beginn
und weiterhin das alte Lied,
dass nichts, tatsächlich nichts geschieht.
Er übt, von Hetzerei befreit,
die südliche Gelassenheit,
was allerdings total missglückt,
weil er zu oft zur Wanduhr blickt.
Er liest ein bisschen Portugiesisch,
was schwieriger erscheint als Friesisch,
besucht entnervt mal die Toilette,
obwohl er's gar nicht nötig hätte.
Es wachsen Durst und Appetit,
doch bleibt's dabei, dass nichts geschieht.
Er würde gerne in den Ohren,
vielleicht gar in der Nase bohren.
Er möchte zwar, doch lässt er's sein,
denn schließlich ist er nicht allein.
Er zählt die Haare auf der Glatze
des Mannes auf dem Nachbarplatze.
Es ist nicht leicht, doch ist er fleißig
und kommt dabei auf dreiunddreißig.
Ermüdung zieht durch sein Gemüt,
weil wieder nichts, rein nichts geschieht.
Allmählich schwindet im Gewühl
das sonst stets wache Zeitgefühl.
Er kauert sich ergeben nieder,
massiert die fast ersteiften Glieder,
ergreift mit schweißverklebtem Pfötchen
ein trockenes und altes Brötchen
und kaut ergebnislos und stumm
auf diesem Stückchen Brot herum.
Im Grunde beißt er auf Granit,
weil nirgends irgendwas geschieht.
Er schließt die Augen halb und träumt,
was er eventuell versäumt,
und ist, bar aller Hoffnungsfunken,
beinahe schon im Nichts versunken
wie ein antiker Eremit,
im Grunde froh, wenn nichts geschieht.
Minuten gehn, es gehen Stunden;
er hat sich damit abgefunden
und ist viel ruhiger geworden.
Die Heimat liegt im fernen Norden.
Er selbst dagegen hier im Süden
ist wunschlos glücklich und zufrieden,
ganz in sich selbst gekehrt und still.
Mag alles kommen, wie es will,
er wird sich schließlich mit Vergnügen
in des Geschickes Ablauf fügen,
sobald der letzte Trotz verglüht,
gerade dann, wenn nichts geschieht.
Als irgendwann und wundersam
die Flugmaschine doch noch kam,
gab's weder Murren noch Gebrumm;
Im Gegenteil, das Publikum
nahm dankbar und mit frohem Sinn
die Freundlichkeit des Schicksals hin.
Man kam, so sehr man vorher grollte,
am Schluss dort an, wohin man wollte.
Christoph Hartlieb
Humor im Lauf der Jahreszeiten
Humanistisches Frühlingslied
Amsel, Drossel, Star und Fink
singen Lieder vom Frühlink,
machen recht viel Federlesens
von der Gegenwart, vom Präsens.
Krokus, Maiglöckchen und Kressen
haben längst den Schnee vergessen,
auch das winzigste Insekt
denkt nicht mehr ans Imperfekt.
Hase, Hering, Frosch und Lachs,
Elke, Inge, Fritz und Max ---
alles, alles freut sich nur
an dem Jetzt. Und aufs Futur.
Heinz Erhardt
Ein Zyklus
Der Frühling
Und wieder ist es Mai geworden,
es weht aus Süden statt aus Norden.
Die Knospen an den Bäumen springen,
und Vogel, Wurm und Kater singen:
fidirallala, fidirallala
Der Herbst
Und wieder ist es Herbst hienieden,
es weht aus Norden statt aus Süden.
Die Knospen an den Bäumen ruhen,
und auch die Kater haben nichts zu tuen.
Rallafididi, rallafididi.
Heinz Erhardt
Perpetuum Mobile
Und der Herbststurm treibt die Blätter,
die ganz welk sind, vor sich her,
und es ist so schlechtes Wetter – – –
ach, wenns doch schon Winter wär!
Und es fallen weiße Flocken,
zwanzig Grad sind es und mehr,
und man friert in seinen Socken – – –
ach, wenns doch schon Frühling wär!
Und der Schnee schmilzt auf den Gassen,
und der Frühling kommt vom Meer,
einsam ist man und verlassen – – –
ach, wenn’s doch schon Sommer wär!
Und dann wird es schließlich Juli,
und die Arbeit fällt so schwer,
denn man transpiriert wien Kuli – – –
ach, wenn’s doch Herbst schon wär!
usw. usw.
Heinz Erhardt
Zeitliches
Der Mensch, soeben erst geboren,
noch Eierschalen hinter'n Ohren,
versteht vom Lebenssinn nicht viel;
auch fehlt es ihm an Zeitgefühl.
Es gelten seine Interessen
allein dem Saufen und dem Fressen.
Ob morgens, mittags, mitternachts,
er quäkt und quält und kräht. Was macht's,
dass er die Eltern übermächtigt,
die sowieso schon übernächtigt,
so dass ihr Zeitgefüge prompt
von Grund auf durcheinanderkommt!
Nimmt er allmählich zu an Jahren,
wird zwar gewitzter sein Gebaren,
doch hält er es für selbstverständlich:
Des Lebens Dauer währt unendlich.
Was morgen sein wird, übermorgen,
macht ihm nicht die geringsten Sorgen.
Mit voller Brust und stolzgeschwellter
frohlockt er, wird er ein Jahr älter.
Die Zeit gleicht einem Riesenmeer:
Er schöpft und schöpft, es wird nie leer.
Sobald er etwas reifer wird,
bemerkt er, dass er darin irrt.
Sein Tun und Lassen ist komplett
hineingepresst ins Zeitkorsett:
Minuten, Stunden, Tage, Wochen,
die ihn beinahe unterjochen.
Geht er zum Abendessen aus,
zum Gottesdienst, ins Krankenhaus,
zum Schwimmbad oder Tête-à-Tête,
fragt er zunächst einmal: Wie spät?
Fängt irgendetwas für ihn an,
stellt er bestimmt die Frage: Wann?
Genauso häufig fragt er bange:
Wie lange dauert das, wie lange?
Terminkalender sowie Uhren
vollbringen offenbar Dressuren
von Menschen, die beharrlich glauben,
nichts könne ihre Freiheit rauben.
Der Fahrplan für die Eisenbahn
und für den Flugverkehr ein Plan
und ungezählte andre Pläne, –
Du weißt schon, diese oder jene, –
die führen dazu, dass er ahnt,
der Mensch sei seinerseits verplant.
Die Uhr, die er am Armband trägt,
auch die, die auf dem Kirchturm schlägt,
der Wecker morgens früh am Tage,
im Radio die Zeitansage,
sie machen deutlich selbst dem Kind:
Die Zeit ist flüchtig, sie verrinnt.
Zwar hört man oft in froher Runde:
Dem Glücklichen schlägt keine Stunde,
doch was sich zeigt als Freudenquell,
verflüchtigt sich besonders schnell,
wogegen das, was uns versauert,
meist ausgesprochen lange dauert.
Geburtstage und Jubiläen
auch keineswegs nur Freude säen.
Sie machen unumwunden kenntlich:
Des Menschen Lebenszeit ist endlich.
Sie saust, nach Busch, im Sauseschritt,
der Mensch kommt manchmal kaum mehr mit.
Die Zunge hängt ihm aus dem Hals
und manches andre ebenfalls.
Schon wieder ist ein Tag vergangen!
Es scheint, er hat kaum angefangen.
Verliebtheit, Urlaub, Jugendzeit,
im Nu sind sie Vergangenheit.
Es lichtet sich des Haupts Behaarung,
wir sammeln Fotos und Erfahrung,
Gerümpel, Kummerspeck und Gold,
auch Niederlagen, ungewollt.
Wir würden gerne alles geben,
bekämen wir: Mehr Zeit zum Leben.
Doch die verrinnt in einer Tour
wie Sand in einer Eieruhr.
Erst wehren wir uns noch und schmollen,
wenn wir nicht kriegen, was wir wollen.
Doch später, müde der Intrigen,
da wollen wir nur, was wir kriegen.
Das Haben wächst, zugleich das Soll.
Mehr ängstlich als erwartungsvoll
schaun wir, was uns die Zukunft bringt,
ob uns ein weitres Jahr gelingt.
Es gibt etwas, das uns bedroht
und voller Schrecken scheint, der Tod,
obwohl er, sagen wir es platt,
bestimmt auch guten Seiten hat:
Ob wir im dunklen Grabe modern,
ob im Verbrennungsofen lodern,
kein Ticken einer Uhr stört mehr,
kein Zeitverlust macht uns Beschwer,
kein Wechselspiel von Tag und Nacht,
kein Auftrag: Morgen um halb acht.
Wir dürfen jeden Bus verpassen,
den Wecker einfach klingeln lassen
und, statt um sechs Uhr aufzustehn,
uns auf die andre Seite drehn.
Wir haben eine Ewigkeit
zum Ausruhn und Verschnaufen Zeit.
Christoph Hartlieb
Witze in Gedichtform
Im Innern Kretas führt ein Priester
ein Eselchen an seiner Hand.
„Weshalb schaut dieses Tier so düster?“,
fragt ein Tourist ihn arrogant.
Der Pope lächelnd ihm bedeutet:
„Stelln Sie sich vor sein Missgeschick:
Ein Geistlicher, der ihn begleitet,
und um den Hals liegt ihm ein Strick.“
* * *
Ein Anruf kommt vom Pastorat
am Abend noch für Dr. Grau:
„Uns fehlt der dritte Mann beim Skat.“
Der Arzt erläutert seiner Frau:
„Ein schwerer Fall, ich fahr sofort.
Es heißt, zwei Pfarrer sind schon dort.“
* * *
Das alte Pfarrerehepaar
sitzt abends unter einer Linde.
Sie streicht ihm durch das lichte Haar:
„War unsre Ehe etwa Sünde?“
Er: „Schatz, ich möchte dich nicht rügen.
Ich frag mich: War sie ein Vergnügen?“
* * *
Die Dame in dem Bücherladen
sucht für den Kranken noch ein Werk.
„Was Frommes wird doch wohl nicht schaden?“ –
„O nein, er ist schon über'n Berg.“
* * *
Ein Patient, dem Tod entflohn,
umarmt den Arzt der Heilanstalt:
„Der Himmel sei Ihr schönster Lohn!“
Der Doktor: „Aber nicht zu bald.“
* * *
Der Pfarrer fragt: „Wird vor dem Mahl
bei euch ein Tischgebet gesprochen?“ –
„Nicht nötig.“ Dann folgt die Moral:
„Denn Mutti kann ganz prima kochen.“
Christoph Hartlieb
Farbenlehre
Das Leben bietet dies und jenes,
zum Glück gelegentlich auch Schönes.
Das ist erfreulich, denn sonst wär
es ziemlich monoton und leer.
Die Augen müssten furchtbar darben,
gäb's nicht für sie die Pracht der Farben:
Gelb, rot, blau, grün mit all den schönen,
kaum aufzählbaren Zwischentönen,
die sich, wenn gute Kräfte walten,
zu wahren Sinfonien gestalten,
sei's die Natur, die überquillt,
sei's ein in Öl gemaltes Bild.
Doch gibt es einige, die sind,
obwohl sie sehen können, blind.
Für sie scheint in der Daseinsschau
grundsätzlich alles grau in grau:
Der Blumenstrauß auf ihrem Tisch,
vielfarbig und verschwenderisch;
der Park, in dem Narzissen blühn,
des Frühlings zartes Maiengrün;
ein Feld von Tulpen ringsumher,
der Sonnenuntergang am Meer,
der Atmosphäre tiefes Blau,
es gibt nur eine Farbe: Grau.
Noch lauter im Getriebe knarrt's,
sieht einer überall bloß schwarz.
Selbst das, was funkelt, strahlt und lacht,
erscheint als rabenschwarze Nacht,
sodass der Mensch, anstatt genießt,
nur angsterfüllt die Augen schließt.
Denn Dunkelheit bedrückt die Seele
und legt sich würgend um die Kehle,
worüber nur ein Masochist,
den Leid erfreut, zufrieden ist.
Dann kommt die große Gruppe derer,
die gelten als Schwarzweißverehrer.
Sie haben optisch einen Knick,
und zwar in jedem Augenblick.
Sie wissen, scheint es, absolut,
was fehlerhaft ist und was gut,
und sie allein entscheiden recht,
ob etwas gut ist oder schlecht,
wobei sie sich zutiefst verkeilen
in einem Netz von Vorurteilen.
So endet meistens die Geschichte:
die anderen sind Bösewichte.
Sie ihrerseits mit großen Gesten
bescheinigen sich weiße Westen,
doch leider und in dubio
sind die Verhältnisse nicht so.
Noch andre suchen die Idylle
durch eine rosarote Brille.
Was sie erblicken, zeigt sich immer
in einem süßlich-warmen Schimmer,
so dass des Lebens Schattenseiten
an ihnen schlicht vorübergleiten,
was zwar den Optimismus nährt,
jedoch der Wirklichkeit entbehrt.
Auch die Partei'n im Parlament
besitzen farblichen Akzent:
Rot zeigen sich die Sozialisten,
als schwarz bezeichnet man die Christen.
Gelb tragen freie Demokraten.
Die Grünen züchten gern Tomaten.
Braun ist beinahe deckungsgleich
mit Nazis aus dem Dritten Reich.
Selbst Menschen teilt man allgemein
nach farblicher Schattierung ein:
Schwarz nennt man oft die Afrikaner
und rot die Uramerikaner.
Die Gelben pflegten ihre Sitte
Jahrtausende im Reich der Mitte.
Die weiße Rasse fühlt dagegen
sich allen andern überlegen,
weil dies so schmeichelnd und behaglich.
Ob sie es wirklich ist, scheint fraglich.
Weiß ist die Unschuld, schwarz der Tod;
der Neid ist gelb, die Liebe rot.
Wer blau ist, hat zu viel gesoffen;
was grün ist, lässt den Menschen hoffen.
Soweit ein Einblick in die Sphäre
symbolgetränkter Farbenlehre,
den jede Frau und jeder Mann
mit Leichtigkeit erweitern kann.
Er wähle aus der Farbengarbe
sich ruhig eine Lieblingsfarbe.
Doch klar sei, ein Aspekt allein
kann nicht und nie das Ganze sein.
Einseitigkeit ist nichts Gescheit's.
Auch das, was anders ist, hat Reiz.
Gerade darin liegt die Würze
in dieses Lebens trüber Kürze.
Die Welt ist nämlich nicht nur rund,
sie ist vor allem herrlich bunt,
vergleiche Autos, Unterhosen,
Tapeten, Haare, Wein und Rosen.
Christoph Hartlieb
Zahnschmerzen
Der Mensch, sofern noch nicht vergreist,
hat ein Gebiss, mit dem er beißt.
Es ist, so wie beim Schwein die Haxen,
ihm von Natur aus angewachsen
am Unterende des Gesichts.
Normalerweise merkt er nichts,
sodass er herzhaft und direkt
in das hineinbeißt, was ihm schmeckt.
Doch manchmal ist es wie verhext.
Da ist ein Schmerz, der wächst und wächst
so wie beim feurigen Finale
an einem Siouxmarterpfahle.
Vielleicht ist es der Zahn der Zeit,
der ihm verursacht solches Leid.
Gerät der Zahn der Zeit in Wut,
spritzt er statt Milch und Honig Blut,
und spritzt er ohne Mitleid weiter,
verwandelt sich das Blut in Eiter.
Es schüttelt ihn ein irrer Schmerz,
reißt ihn empor und himmelwärts.
Gleichzeitig rast durch sein Gebein
die schauerlichste Höllenpein,
sodass er ganz und gar vergisst,
ob Männchen er, ob Weibchen ist.
Er gäbe gern sein letztes Hemd,
würd' nur dies Bohren eingedämmt.
Er schleicht sich fort zu diesem Zwecke
zum nächsten Zahnarzt um die Ecke,
wodurch, so denkt er wohlbegründet,
er die gesuchte Heilung findet.
Er macht sich auf mehr tot als lebend,
halb hoffnungsfroh, halb widerstrebend,
obwohl er vieles nicht durchschaut
und ihm vor noch mehr Übel graut,
doch andrerseits und überhaupt
er an Erfolg und Fortschritt glaubt.
Betritt er dann das Wartezimmer,
erlischt beinah sein Hoffnungsschimmer
im Kreis der traurigen Gestalten,
die sich nur mühsam aufrechthalten,
verängstigt mit den Füßen scharren
und trüben Blicks ins Leere starren.
Er blättert mit zermürbten Kräften
in schmierigen Gesundheitsheften,
wo farbenfroh und unbeirrt
Zahnmedizin gepriesen wird,
die, heißt es darin frank und frei,
der Menschen Freund und Helfer sei
und, so versteht sie ihre Rolle,
allein des Menschen Bestes wolle,
wozu ihm wie ein Blitz einfällt:
Des Mensch Bestes ist sein Geld,
worauf er, erst noch zugeknöpft,
allmählich neue Hoffnung schöpft.
Auf einmal fängt sein Nebenmann
zu keuchen und zu röcheln an.
Sein Kopf wird rot, sein Auge zuckt,
wobei er in ein Schnupftuch spuckt.
Der Mensch, im tiefsten Sein erschüttert,
sitzt wie gelähmt dabei und zittert
und spürt im Nu und Handumdrehn
den Hauch des Todes um sich wehn.
Er faltet schweigend und betreten
die feuchten Hände wie zum Beten.
Es fällt ihm ein, dass sein Pastor
entschieden auf das Beten schwor,
das, wenn man in der Tinte sitzt,
bestimmt nicht schadet, sondern nützt;
gedenkend auch der Mutter Rat:
Erst ein Gebet und dann die Tat.
Zwar fehlen ihm an diesem Orte
die passenden und frommen Worte,
doch hofft er, wenn es darum geht,
dass Gott ihn ohnedies versteht.
Er schließt die Augen, schaut nach innen,
um über's Schicksal nachzusinnen,
wobei ihn sein Gewissen pufft:
Ja, in der Tat, er ist ein Schuft.
Sein Leben, das vorüberhuscht,
ist so vermurkst, verkorkst, verpfuscht.
Er schwört beim Barte des Propheten,
in Zukunft häufiger zu beten
und fern von sumpfigen Gewässern
sich endlich radikal zu bessern, –
wodurch man sieht, des Körpers Pein
kann für die Seele heilsam sein.
Sie wird, wie Hiob schon bescheinigt,
durch Schmerz geläutert und gereinigt.
Was sinnlos schien, hat dennoch Sinn,
und der Verlust wird zum Gewinn.
Auch dies Erlebnis voller Qual
entbehrt mitnichten der Moral:
Verehrter Leser, Mitmensch, Christ,
sobald ein Nerv entzündet ist,
kommt ein erleichterndes Gebet
in aller Regel viel zu spät.
Bist Du jedoch von Schmerz befreit,
dank zahnärztlicher Tätigkeit,
geht's dir durch des Chirurgen Messer
nach schwerer Krankheit wieder besser
und freust Du dich an Deinem Leben,
nachdem man dich längst aufgegeben,
dann tue ohne Vorbehalt,
was Du gelobt hast, und zwar bald,
denn wie gesagt, in Schwulitäten
fehlt oft Gelegenheit zum Beten.
Christoph Hartlieb
Alltagsleben und was danach kommt
Es dürfte keine Steuern geben,
kein Zahnweh, keine Schützengräben,
dann wär‘ auf dieser Welt das Leben
vielleicht noch schöner als wie eben.
Heinz Erhardt
Die Gardinenpredigt
An den blumigen Gardinen
hängen Reste deiner Predigt,
und seitdem du sie gehalten,
bin ich für die Welt erledigt.
Einsam schleich ich durch die Landschaft.
Und der Schwager und die Nichten
zeigen nun auf mich mit Fingern,
statt mich wieder aufzurichten.
Bis zur nächsten großen Wäsche
muss ich meine Wohnung meiden,
denn ich kann diese Gardinen,
die geblümten, nicht mehr leiden.
Heinz Erhardt
Bei Opa
Der Opa ist ein frommer Mann
und liest in seiner Bibel.
Die Oma schneidet nebenan
fürs Abendbrot die Zwiebel.
Der Opa ist ein frommer Mann
und weint ob seiner Sünden.
Auch Omama weint nebenan,
jedoch aus andern Gründen.
Heinz Erhardt
Nächstenliebe
Die Nächstenliebe leugnet keiner,
doch ist sie oft nur leerer Wahn,
das merkst am besten du in einer
stark überfüllten Straßenbahn.
Du wirst geschoben und musst schieben
der Strom der Menge reißt dich mit.
Wie kannst du da den Nächsten lieben,
wenn er dich auf die Füße tritt?!
Heinz Erhardt
An einen Pessimisten
Jede Sorge, Freund, vermeide,
jedes Weh sollst du verachten.
Sieh die Lämmer auf der Weide:
sie sind fröhlich vor dem Schlachten.
Ahnst du nicht, wie dumm es wär,
wären sie's erst hinterher?
Heinz Erhardt
Das Schloss
Papst Paul war gestorben vor vierhundert Jahren
und ist dann, wie üblich, gen Himmel gefahren.
Und als er dort oben gut angekommen,
da hat er den güldenen Schlüssel genommen.
Es ist ja bekannt, dass früher und itzt
jeder Papst einen Schlüssel zum Himmel besitzt.
Doch siehe, der Schlüssel, der wollte nicht passen.
Der Petrus hat trotzdem ihn eintreten lassen
und sprach (sein Antlitz war bartumrändert):
"Der Luther hat nämlich das Schloss verändert...!“
Heinz Erhardt
Ein Nachruf
Du warst ein Musiker und Dichter,
ein Maler und Kaninchenzüchter;
doch trotzdem war‘s dir nicht gegeben,
den eigenen Tod zu überleben. –
Wir wollen nur das eine hoffen,
das du‘s dort oben gut getroffen.
Heinz Erhardt
Was ich gerne wäre
Lächeln
Ich möchte gern ein Lächeln sein,
das heißt, vermitteln und verzeihn,
Grundlagen des Vertrauens legen
und starre Fronten neu bewegen.
Wo Kälte herrscht, weil keiner spricht,
Zusammenhängendes zerbricht,
Gemüter sich vor Zorn erhitzen,
gescheite Worte nichts mehr nützen,
wo Menschen bang und ängstlich sind,
vor Eigennutz und Dummheit blind,
verzweifelt um Verluste weinen,
abrupt und maskenhaft versteinen,
da flög' ich wie ein Funken Licht
auf des Betroffenen Gesicht,
um es von innen zu erhellen
und so Versöhnung herzustellen.
Ich möchte gern ein Lächeln sein,
Bestätigung und Widerschein
der Kraft, die in der Tiefe gründet
und sich dem guten Ziel verbündet.
Gedanke
Ich möchte ein Gedanke sein,
geformt in klassischem Latein,
erdacht von einem Philosophen
in kalter Nacht am warmen Ofen
von Freiheit, Glück, Gerechtigkeit
und Frieden, der im Volk gedeiht;
davon, dass Menschen lachen können
und anderen das Beste gönnen.
Unsichtbar, lautlos, ungreifbar,
doch überwältigend und wahr,
so würde ich durch Mauern schleichen
ins Hirn von Mächtigen und Reichen.
Ich wäre unausrottbar da,
allüberall, fern oder nah,
in Vorstadtslums und Krankenzimmern
und dort, wo Kriegsverletzte wimmern.
Und hätte sich des Guten Macht
gefestigt und vertausendfacht,
dann würde ich mich selbst vergessen
und in ein Nichts zusammenpressen.
Luftballon
Ich wäre gern ein Luftballon,
beschwingtes Glückskind der Saison,
zart rot, getönt mit grünen Tupfen
und einem Band daran zum Zupfen.
Erst läge ich zerfurcht und weich
im irdisch-unteren Bereich;
ein Nichts, ein Schwächling, eine Niete,
und zwar auf jeglichem Gebiete.
Doch würde mich ein Mensch befrein
und atmete mir Wärme ein,
dann würde ich mich in Sekunden
zur prallen Augenweide runden.
Ich zöge sanft an meiner Schnur
dank meiner luftigen Natur,
von Lust gepackt, mich zu erheben
und stillvergnügt emporzuschweben.
Und hätte ich einmal genug
von meinem Himmelhöhenflug,
würd' ich an einem Wölkchen kratzen
und ohne Bitterkeit zerplatzen.
Möwe
Ich möchte eine Möwe sein
in Sturmgebraus und Sonnenschein:
kein Adler, Büffel oder Löwe,
nein, schlicht und einfach eine Möwe.
Ich möchte wie die Möwen schrein
im Schwarm mit andern und allein;
wo Meer und Land zusammenprallen,
hoch oben schweben und nicht fallen.
Ich möchte jenseits aller Pein
der Sehnsucht Möwenflügel leihn,
befreit von erdenschweren Dingen
zu fernen Horizonten schwingen.
Ich möchte eine Möwe sein,
tief unter mir mein Leichenstein,
um federleicht hineinzugleiten
in grenzenlose Ewigkeiten.
Christoph Hartlieb