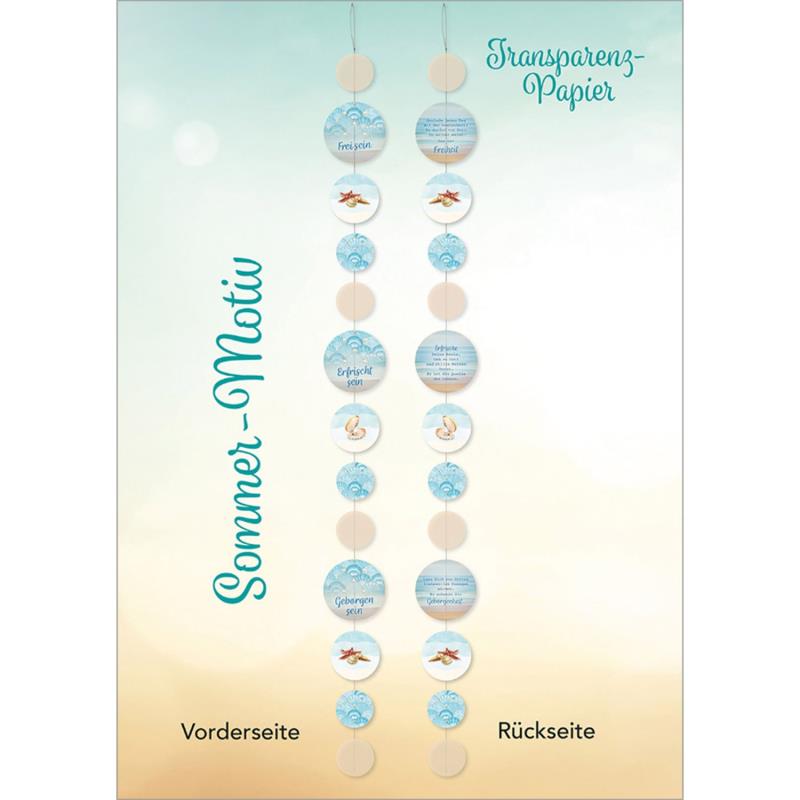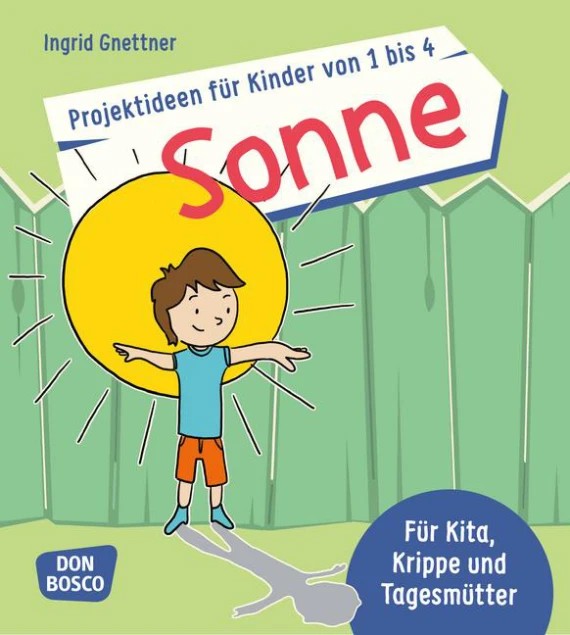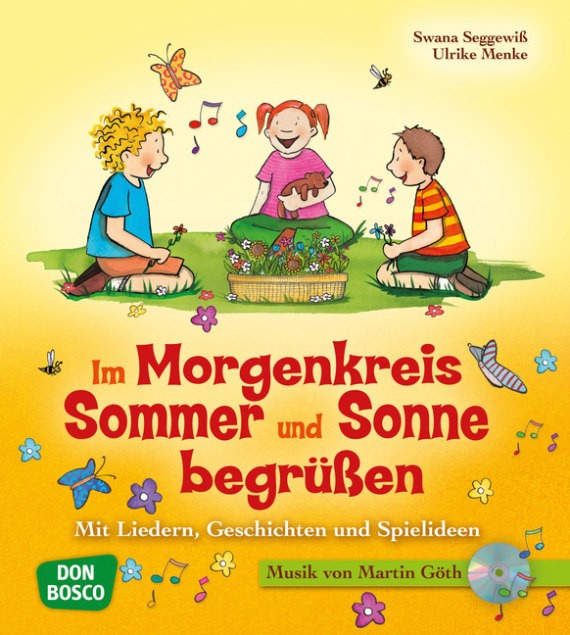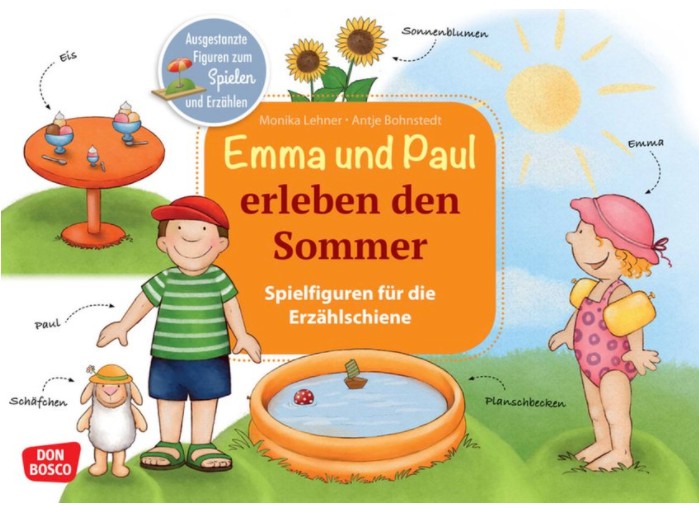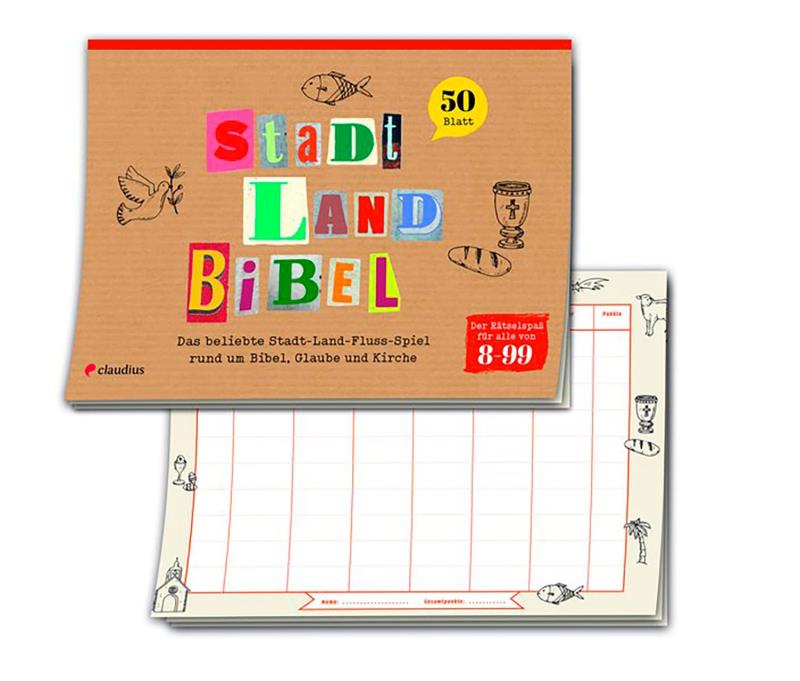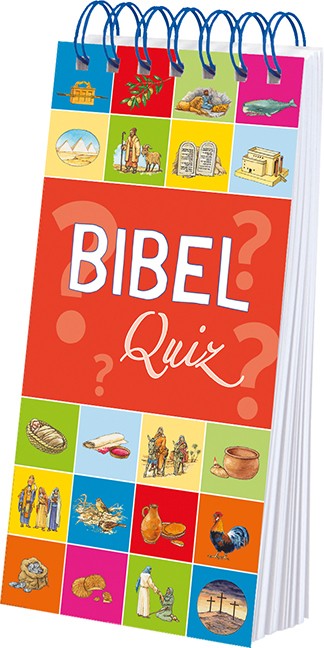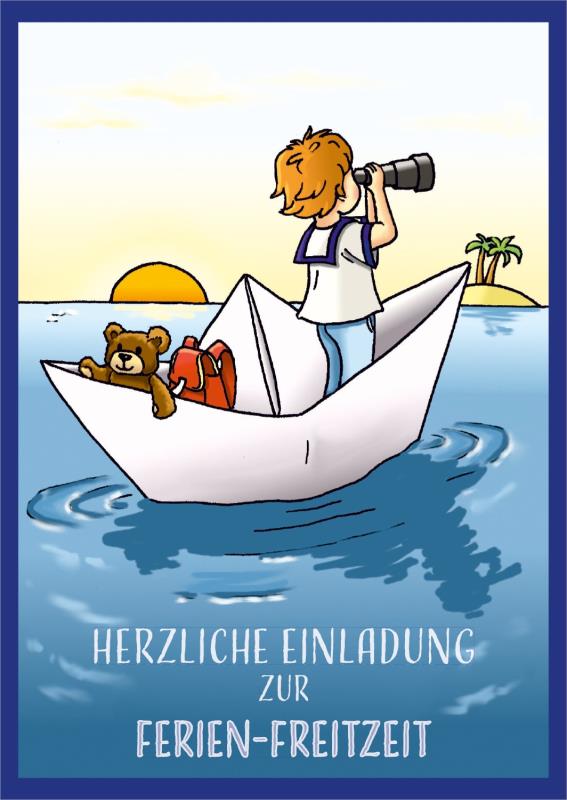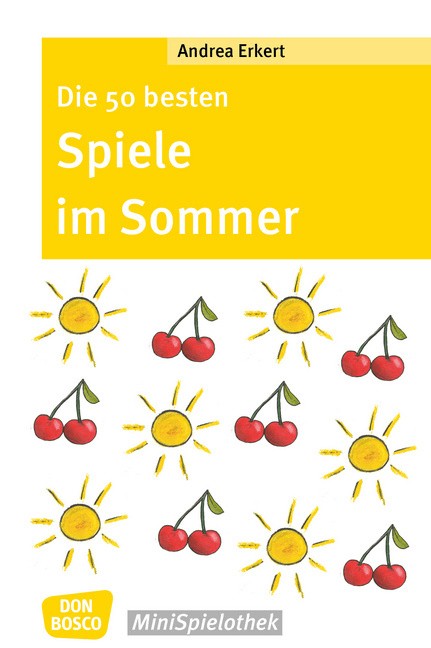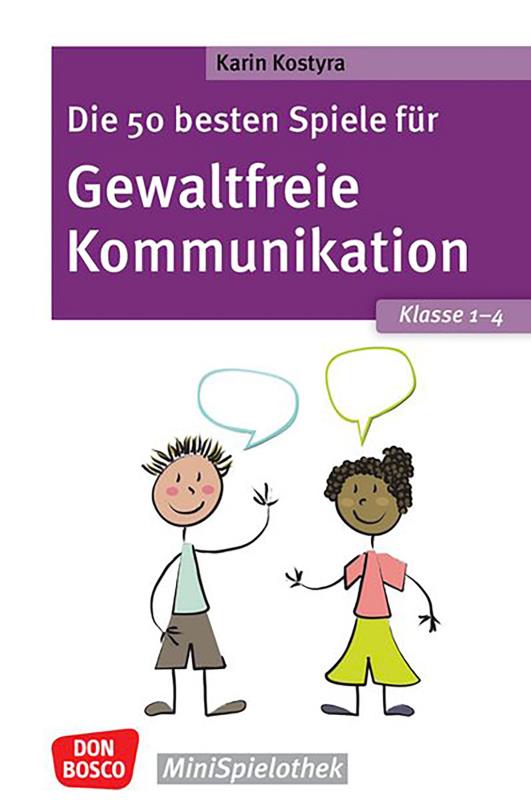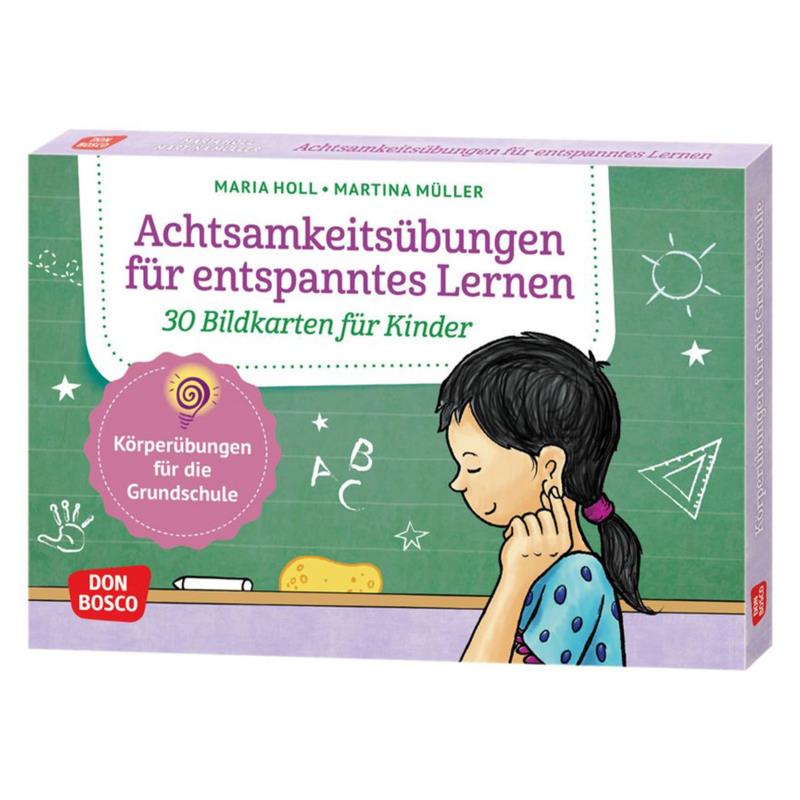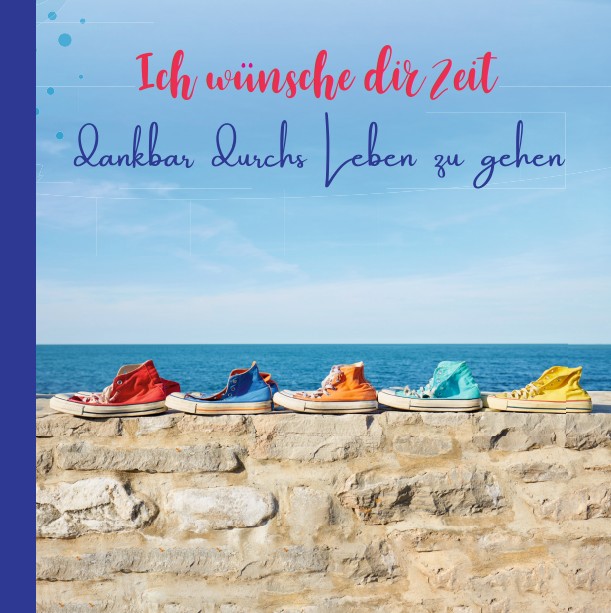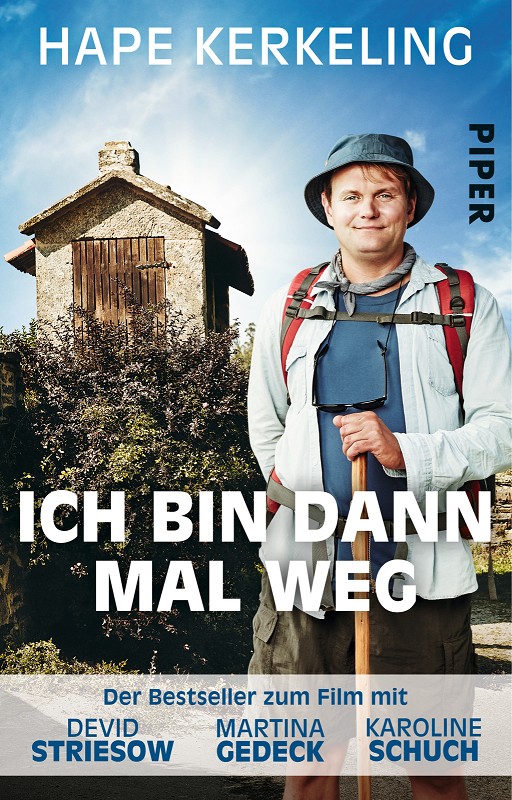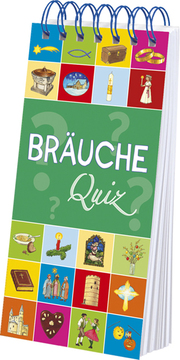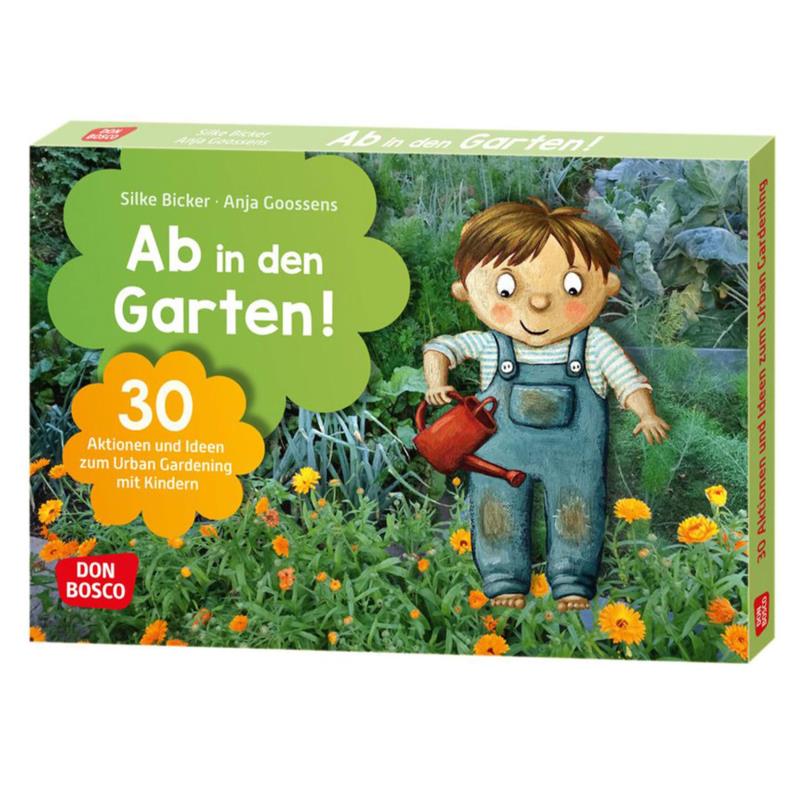- Impulse durch das Kirchenjahr
- Kinderseite
-
Wissensbibliothek
- Christliches Lexikon
-
Feiertage & Brauchtum
- Advent
- Allerheiligen
- Allerseelen
- Aposteltage
- Aschermittwoch
- Buß- und Bettag
- Christi Himmelfahrt
- Darstellung des Herrn
- Dreifaltigkeitssonntag (Trinitatis)
- Dreikönigsfest - Heilige drei Könige
- Erntedank
- Erstkommunion
- Ewigkeitssonntag / Christkönig
- Fastenzeit / Passion
- Fastnacht / Fasching / Karneval
- Firmung
- Fronleichnam
- Gründonnerstag
- Heiligstes Herz Jesu
- Hochzeit / Trauung
- Hochzeitsjubiläen
- Johannistag
- Karfreitag
- Karsamstag
- Karwoche
- Kirchenjahreskreis
- Kirchweihfest
- Konfirmation
- Losungen
- Maiandachten
- Mariä Himmelfahrt
- Marienfeste
- Sankt Martin
- Michaelis
- Muttertag
- Neujahr
- Nikolaustag
- Ostern
- Palmsonntag (Palmarum)
- Pfingsten
- Rauhnächte
- Reformationsfest
- Silvester
- Sonntage nach Epiphanias
-
Sonntage nach Trinitatis
- Taufe
- Vatertag
- Verkündigung des Herrn
- Weihnachten
- Heilige & Namenstage
- Jahreslosungen
- Gelebter Glaube
- Blog
Sonntage nach dem Dreifaltigkeitssonntag (Trinitatis):
Sonntage nach Trinitatis
In der lutherischen Kirche wird der Sonntag nach Pfingsten Trinitatis-Sonntag (Dreifaltigkeitssonntag) genannt. Die Sonntage danach werden dann als „1. Sonntag nach Trinitatis“, „2. Sonntag nach Trinitatis“ usw. bezeichnet.

Inhalt:
1. Evangelisches Phänomen
2. Namensbedeutung & zeitlicher Rahmen
2.1 Frühere Zählung
2.2 Feste während der Trinitatis-Zeit
3. Die Sonntage am Ende des Kirchenjahres
3.1 Bibeltexte zu den Sonntagen nach Trinitatis
3.2 Drittletzter Sonntag (32. Sonntag im Jahreskreis)
3.3 Vorletzter Sonntag (33. Sonntag im Jahreskreis)
3.4 Buß- und Bettag
3.5 Letzter Sonntag im Kirchenjahr
4. Kreative Ideen
Evangelisches Phänomen
Nur noch in der evangelischen Kirche kann man für zum Beispiel einen der September-Sonntage den Namen „der 17. Sonntag nach Trinitatis“ hören. Damit wird bis heute eine Bezeichnung beibehalten, die in den evangelisch-lutherischen Kirchen schon ungefähr so lange gebräuchlich ist, wie es diese reformatorische Kirche gibt.
In der römisch-katholischen Kirche gab es eine solche Benennung eines Sonntages noch nie. Stattdessen heißen hier die Sonntage zwischen der Osterzeit und der Vorweihnachtszeit die „Sonntage im Jahreskreis“.
Namensbedeutung & zeitlicher Rahmen

Die „Sonntage nach Trinitatis“ bedeuten auf Deutsch „Sonntage nach dem Dreifaltigkeitssonntag“ oder „Sonntage nach dem Dreieinigkeitsfest“. An diesem Fest „Trinitatis“, das immer am ersten Sonntag nach Pfingsten gefeiert wird, wird die dreifache Erscheinungsweise Gottes als Vater, Sohn und Heiliger Geist herausgestellt. Diesem Sonntag schließt sich dann die Zählung der folgenden Sonntage bis zum Anfang des neuen Kirchenjahres im Advent an – also der „1.“ bis „19.“ oder „24. Sonntag nach Trinitatis“.
Der Beginn dieser Reihe von Sonntagen sowie die Anzahl der sogenannten Trinitatissonntage ist in jedem Jahr unterschiedlich. Beides richtet sich nämlich danach, wie früh oder spät Ostern und damit Pfingsten und das folgende Trinitatisfest im jeweiligen Jahr gefeiert wird.
Liegt Ostern also früh, beispielsweise auf dem 22. März, kann es – in diesem Höchstfall – 24 Sonntage nach Trinitatis geben. Liegt Ostern jedoch spät, zum Beispiel auf dem 25. April, verkürzt sich die Zahl der Trinitatissonntage entsprechend: der 20. bis 24. Sonntag nach Trinitatis müssen dann entfallen.
Frühere Zählung
Vom Michaelisfest (29. September) an war nach der älteren Ordnung auch eine Zählung „nach Michaelis“ möglich. Dabei entsprach der „1. Sonntag nach Michaelis“ dem „19. Sonntag nach Trinitatis“.
Feste während der Trinitatis-Zeit
Trinitatis, Michaelistag, Erntedank, Reformationsfest, Sankt Martin, Buß- und Bettag, Ewigkeitssonntag
Die Sonntage am Ende des Kirchenjahres
Das Ende des Kirchenjahres trägt im evangelischen Bereich ein eigenes Gesicht: Der Drittletzte, Vorletzte und Letzte Sonntag des Kirchenjahres (Ewigkeitssonntag) haben jeweils ein eigenes, feststehendes Proprium und werden immer begangen.
Bibeltexte zu den Sonntagen nach Trinitatis

Die wundersame Brotvermehrung
(Siebter Sonntag nach Trinitatis)
In der Reform der evangelischen Leseordnung (Lutherisches Lektionar, 1978) hat man versucht, den Sonntagen nach Trinitatis ein deutlicheres Profil zu verleihen: Nach dem „Prinzip der Konsonanz“ sollten die Lesungen an den einzelnen Sonntagen inhaltlich eine Verbindung zueinander haben. Als Grundlage nahm man meist das überlieferte Sonntagsevangelium und ergänzte zwei passende Lesungen (aus Altem Testament und Epistel). Dadurch bekam jeder der Sonntage ein Thema zugeordnet. Eine besondere Rolle spielen dabei die großen, einprägsamen Gleichniserzählungen einiger Trinitatissonntage. Das neue Evangelische Gottesdienstbuch übernahm diese Leseordnung – mit einigen kleineren Änderungen am 3. und 10. Sonntag nach Trinitatis und am Erntedanktag.
Drittletzter Sonntag (32. Sonntag im Jahreskreis)
Nach der evangelischen Ordnung bestimmt das Evangelium Lk 17,20–24(25–30) den Charakter dieses Sonntags: Es geht um das unerwartete Kommen des Reiches Gottes. Die Epistel Röm 14,7–9 enthält einen tröstlichen Klang: Christus ist Herr über Lebende und Tote. In einer Präfation für die Endzeit des Kirchenjahres heißt es im Gottesdienstbuch: „Wir danken dir, weil durch ihn das Alte vergangen ist und wir in ihm eine neue Schöpfung geworden sind.“
Nach der katholischen Ordnung handeln die 2. Lesung und das Evangelium im Lesejahr A ebenfalls vom endzeitlichen Kommen Christi und von der Auferweckung der Toten (1 Thess 4,13–18; Mt 25,1–13: Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen). Im Lesejahr B nimmt die 2. Lesung (Hebr 9,24–28) auf die Wiederkunft Christi Bezug. Im Lesejahr C thematisieren die 1. Lesung (2 Makk 7,1–2.9–14) und das Evangelium (Lk 20,27–38) die Hoffnung auf die Auferweckung der Toten und das neue Leben in Gottes Reich.
Verschiebung der liturgischen Texte
Entfallen der 20. bis 24. Sonntag nach Trinitatis (siehe Abschnitt Zeitlicher Rahmen), dann ist vorgesehen, dass der Drittletzte Sonntag auch mit dem Proprium des 24. Sonntags nach Trinitatis begangen werden kann; die Texte des 23. Sonntags nach Trinitatis können mit denen des 20. Sonntags nach Trinitatis ausgetauscht werden.
Bei der Anwendung der Zählung nach Michaelis fallen die entsprechenden überzähligen Sonntage schon vor dem Michaelisfest fort.
Vorletzter Sonntag (33. Sonntag im Jahreskreis)

Jesus im Weltgericht
Im Mittelpunkt des Gottesdienstes evangelischer Gemeinden steht das Evangelium Mt 25,31–46, das große Gleichnis vom Weltgericht: „Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ Die Epistel Röm 8,18–23(24–25) artikuliert die Sehnsucht der ganzen Schöpfung nach Erlösung. Als Wochenlied singt man die Umdichtung der alten Sequenz „Dies irae, dies illa“ aus den Messen für die Verstorbenen: „Es ist gewisslich an der Zeit, dass Gottes Sohn wird kommen ...“ (EG 149). Im Rahmen der Friedensdekade kann hier – wie schon am vorhergehenden Sonntag – das Proprium „Bitte um Frieden und Schutz des Lebens“ genommen werden (Lesungen: Mi 4,1–4, 1 Tim 2,1–4 oder Phil 4,6–9, Mt 5,2–10 [11–12] oder Mt 16,1–4 bzw. Joh 14,27–31 a).
Im Lesejahr A der katholischen Ordnung liest man Spr 31,10–13.19–20.30–31, 1 Thess 5,1–6 (unerwartetes Kommen des Endes „wie ein Dieb in der Nacht“) und Mt 25,14–30 (Gleichnis von den anvertrauten Talenten; Gericht). Noch deutlicher kommen im Lesejahr B (Dan 12,1–3; Hebr 10,11–14.18; Mk 13,24–32) und C (Mal 3,19–20a [4,1–2a]; 2 Thess 3,7–12; Lk 21,5–19) endzeitliche Themen zum Zuge. Die Gebete des Tages sprechen von der Treue im Christusdienst (Tages- und Gabengebet) und der Hoffnung auf ewige Gemeinschaft mit Christus (Gabengebet).
Am vorletzten Sonntag im Kirchenjahr wird außerdem der weltliche Volkstrauertag begangen.
› Mehr Informationen über den Volkstrauertag
› Volkstrauertag - Was ist das eigentlich? (Blogbeitrag)
Buß- und Bettag
› Informationen zu den Bibeltexten am Buß- und Bettag
Letzter Sonntag im Kirchenjahr
› Informationen zum Letzten Sonntag (Ewigkeitssonntag / Totensonntag)
Ideen für den Sommer entdecken:
Literaturhinweise
- www.logo-buch.de
- Durch das Jahr – durch das Leben. Hausbuch der Christlichen Familie. Kösel (1982)
- Feste des Lebens. Ein biblisches Hausbuch. Deutsche Bibelgesellschaft (1993)
- Hermann Kirchhoff: Christliches Brauchtum. Feste und Bräuche im Jahreskreis. Kösel (1995)
- Alfred Läpple: Kleines Lexikon des christlichen Brauchtums. Pattloch (1996)
- Karl-Heinrich Bieritz: Das Kirchenjahr. Feste, Gedenk- und Feiertage in Geschichte und Gegenwart. Beck‘sche Reihe (2001)